


 MENU
MENU

„Könnte es sein, dass wir uns schon bald trennen?“, sangen die Beatles ahnungsvoll in „We can work it out“ und eben lange vor der Kanzlerin: „Wir können es schaffen“. Sie haben es nicht geschafft. Aufstieg und Zerfall der „Fab Four“ aus der Sicht ihres Schlagzeugers Ringo Starr zu schildern und obendrein, was man nicht wissen kann, mit Variationen von Möglichkeiten zu ersetzen, hat Rainer Wieczorek unternommen. Und PH Gruner hat es gerne aufgenommen.
2025 feiert Ringo Starr seinen 85. Geburtstag, am 7. Juli. Der ältere der beiden noch lebenden Beatles. War dies ein Kalkül für die „Ringo-Variationen“ von Rainer Wieczorek? Möglich. Und durchaus sinnig. Alles, was mit den Fabulous Four in Verbindung zu bringen war in den vergangenen Jahrzehnten – Musik, Film, Comic, Erinnerungen, Fotobücher, Versteigerungen von Instrumenten und Devotionalien – hatte Aufmerksamkeit per se sicher. Ein Phänomen von erstaunlicher Langlebigkeit inmitten gerade jener Zeitläufte, die jedem seine „15 Minuten Ruhm“ (Andy Warhol) versprachen. Die Beatles bilden demnach geradezu eine Antithese zu Warhol. Inzwischen aber ist der Kern der einst vernarrten weltweiten Fans eben auch seine 65 bis 85 Jahre alt, eine große Baby-Boomer-Kohorte des Pop.
Heutzutage verströmt ein Buch über den Schlagzeuger Ringo Starr einerseits den Charme eines Retro-Märchens, andererseits steht es für die Option, all dem längst Durchgenudelten vielleicht eine neue Facette, eine neue Tönung zu entlocken. Und wenn eine solche nicht mehr zu finden ist – alle weg, alle schon verspeist –, dann erdenkt man sie sich, man dichtet, und zwar hinzu. Rainer Wieczorek unternimmt dieses literarische Wagnis unter Zuhilfenahme eines weiteren Musikernamens. Und mithilfe eines berühmten musikalischen Werks von Johann Sebastian Bach, der „Clavier-Übung“ für Cembalo von 1741 (BWV 988), die später das umstrittene, aber doch erfolgreich etablierte Etikett „Goldberg-Variationen“ erhielt.
In den „Ringo-Variationen“ schafft es Wieczorek, auf 118 Seiten die musikhistorischen Welten nicht aufeinanderprallen zu lassen, sondern sanft und unaufgeregt aufeinander zuzubewegen. Wieczorek möchte dem Ringo, „dem man zu kennen glaubt“, den „eigenen Ringo“ hinzugesellen, „um zu hören, was er zu erzählen hat“.
Des Autors Konzept ist im Grunde eine biografische Novelle mit fiktionalen Weiterungen. Und Novelle kann er. Mit seinen Künstlernovellen „Tuba-Novelle“ oder „Der Intendant kommt“ und seinen Komplementär-Novellen „Kreis und Quadrat“ sowie „Form und Verlust“ hat er seit 2005 eine irgendwie aus der Mode und der Moderne gefallene literarische Gattung wieder mit Leben erfüllt. Konsequent, nachhaltig, feinnervig.
Die „Ringo-Variationen“ erfüllen viele Standards der Novelle, auch wenn sie nicht so benannt sind: Eine überwiegend lineare Handlungsführung, die Konzentration auf einen Protagonisten, sein Leben, Schicksal, Seelenheil. Und das singuläre Ereignis: in diesem Falle der Fund eines Plattenspielers in einer Hotelsuite mit einer LP der „Goldberg-Variationen“ auf dem Teller.
Was wir aber lesen und miterleben ist in weiten Teilen eine Genese der Beatles aus der Sicht von Richard Starkey, dem einstigen Maschinenschlosser-Lehrling aus Liverpool, der sich umbenennt in Ringo Starr und in einer Band spielt namens Rory Storm & the Hurricanes mit einem Bandleader, der bürgerlich Alan Caldwell heißt. Eine Phalanx der Masken tut sich auf, das stete Häuten und Ein-Anderer-sein-wollen. Alle möchten die Armut abstreifen, die auch eine Orientierungsarmut ist. Und bald kreuzen sich die Wege des Schlagzeugers hinter dem Ludwig-Trommelset mit der Erstformation der Beatles.
Hamburg lässt grüßen, die Stadt, die die Royal-Air-Force kaum 20 Jahre davor mit der Operation „Gomorrha“ in Schutt und Asche zerbombt und mit einem Feuersturm ohne Vergleich fast gänzlich dahingerafft hatte. In Hamburgs „Kaiserkeller“ spielen die ungestümen Gastbands von der Insel für 1,25 britische Pfund pro Abend – für sechs bis sieben Stunden Musik. Unglaubliche Grundbedingungen auch für die jungen Beatles, die allesamt nicht in der Lage sein können, zu erahnen, was mit Ihnen noch geschehen wird. Und in welchem Tempo. 1962 ergattern die Beatles durch den legendären George Martin ihren ersten Plattenvertrag, und mit Brian Epstein, ihrem später ebenso legendär werdenden Manager, hebt die Rakete 1962 ab. Den Beatles mit den Lederjacken werden Bandkostüme verpasst, die fast lächerlich angepasste Jüngelchen aus ihnen machen, und nach jedem Lied gilt ab sofort der Imperativ: braves Verbeugen im Quartett.
Mit einem extrem banalen Teenie-Liedchen wie „Love Me Do“ wird die Hitparade erobert. In jener Zeit kommt „Love“ 25 mal in jedem Beatles-Song vor. Gegen „Love Me Do“ wirken Wortfolgen des deutschen Schlagers von Rex Gildo oder Roberto Blanco wie literarisch vielschichtige Konstrukte. Und dann noch die Frisuren: Der deutsche Fotograf Jürgen Vollmer, der sich selbst schon als Schuljunge die Fransen als Pony in die Stirn gekämmt hatte, verpasst diesen Look bei einem Treffen in Paris auch allen vier Beatles. Die Kombi ist nachdrücklich schräg und nicht zu verschubladen: Seltsame Modeanzügchen, sittsames Verbeugen nach jedem Musikstück, Pony auf dem Schädel.
Wieczorek erzählt die gesamte Beatlemania durch Ringos Kopf und Augen und ganz entlang der Beatles-Bandgeschichte. Die ersten und die ständig größer werdenden Erfolge, die Erfolge, die allen über den Kopf wachsen, die ermüdenden Endlos-Tourneen mit endlos schreienden jungen Menschen, nicht zuletzt Mädchen, die agieren wie unter schwerem, bewusstseinsveränderndem Drogenkonsum. All das aber kennen wir, auch die gruppeninternen Streits und Spannungen, wir kennen alles aus vielen Berichten, Erzählungen, Artikeln, Interviews, Biographien. Das Buch bleibt hier allzu sehr im Gleis der Bandhistorie gefangen. Ringo als Erzähler ist ein Nacherzähler und die LP-Stationen über „Rubber Soul“ bis zu „Abbey Road“ und „Let It Be“ markieren die Abfolge der bekannten Bahnhöfe an der Strecke bis zum finalen Prellbock für die Band im Jahre 1970. Es ist wie Fahrplanlesen.
Mittendrin geschieht das Disruptive. Das Element des faszinierend Anderen. Wieczorek legt es dem mit Bademantel um den Leib und mit Rotwein in der Hand durch die Hotel-Suite schwebenden Ringo auf den Sideboard-Plattenspieler. Er ist verzückt. „Eine ganz leise Klaviermusik war das. Sehr langsam. Sie atmete mit mir.“
Nun denn. Wäre dies ernstlich denk- und erwartbar von einem Drummer, der sich ohne jede familiäre musikdidaktische Unterweisung, ohne musiktheoretische und musikgeschichtliche Kenntnis in sein Musikerleben vorgetrommelt hat? Falsche Frage. Autor Wieczorek macht es einfach. Er sympathisiert mit jener so generell unterschätzten Nummer vier der Beatles, die die Kollegen stets nur von hinten sieht, meist auch etwas erhöht sitzt, und von dort oben für Takt, Beat und Groove sorgt. Die anderen können für sich selbst sorgen, Ringo braucht Hilfe und Helfer. So schien es immer.
Dennoch: Die Wahrscheinlichkeit des Ringo-Interesses für Bach und den manischen Bach-Interpreten Glenn Gould ist menschlich gesehen kristallreines Konstrukt. Ein intellektuell durchkomponierter Überraschungseffekt in der Faktur dieser Fast-Novelle, ein literarisch ausgekosteter Filmschnitt. Oder eben: ein Plattenwechsel. Und vieles bietet sich ja bezirzend an: Gould ist teils Beatles-Zeitgenosse, teils Leidensgenosse des Konzerthallen-Musikgeschäftes, teils esoterisches Enigma und das absolute Gegenteil vom Leben in Musik-Ensembles. Gould hasst Publikum. Jeder Huster im Parkett ist ihm Majestätsbeleidigung. Folgerichtig ist sein fast pathologisch-radikaler Abschied von der Bühne 1964, da ist der Virtuose 32 Jahre alt. Seine Perfektion möchte und kann er nur noch auf Band und Platte festhalten. Die Beatles vollziehen ihren eigenen Bühnenabschied im Jahre 1966. Und nein, sie hassen ihr Publikum nicht. Es geht ihnen einfach zu heftig an ihre vier Hälse. Die Exzessivität der Zuneigung ist ihnen unheimlich.
Was macht nun dieses Buch aus? Es montiert die Geschichte von vier berühmten britischen Pop-Musikern in den notwendig erweiterten Kontext von Leidenschaft und Leiden, von Ambition und Aggression, von Flüchten oder Standhalten, um mit Horst-Eberhard Richter zu sprechen. Eine ganze Weile halten die Fab Four dem Trubel ihrer Ikonisierung stand. Dann treibt es sie in die Flucht. Voreinander. Auseinander. Das Standhalten gelingt mit einer Schein-Toleranz untereinander, die sich aufbaut auf dem, was Wieczorek seinen persönlichen Ringo so formulieren lässt: „Wie funktionierten als Gruppe Ähnlicher. In Wirklichkeit wurden wir uns immer unähnlicher.“
Und das Durchhalten gelang auch mittels Abschottung im „Yellow Submarine“, überaus gut getarnt als kindhaftes Lied mit süffig-schlichtem Refrain. Dieses maritime Gefährt ist ein Symbol. Wieczoreks Ringo: „Das Lied selbst war ein U-Boot. Es erzählte von der Situation, in die wir geraten waren: In bunte Hüllen gekleidet, abgeschottet von der Außenwelt.“
Ringo mit Bach im „Yellow Submarine“: Eine insinuativ literarisierte Fiktion, unaufdringlich, knapp, leichtfüßig und empathisch erzählt von einem – unverkennbaren – Fan.
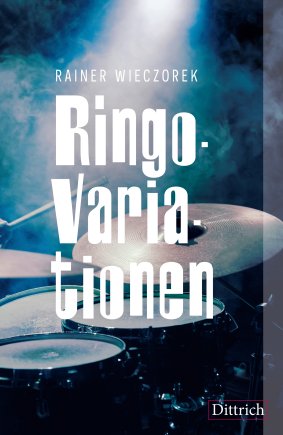
Rainer Wieczorek
„Ringo-Variationen“
120 S., geb.
ISBN: 978-3-910732-23-0
Dittrich-Verlag, Weilerswist 2025
Bestellen
Erstellungsdatum: 10.05.2025