


 MENU
MENU

Der Apfel fällt zuweilen doch unter andere Stämme. Schriftsteller, Musiker, Künstler aller Geschlechter, die aus bildungsfernen, prekären Verhältnissen kommen, gegen alle Erwartung und Widerstände einer milieufremden Berufung folgen, sind gar nicht so selten. Die kämpferische Anstrengung, mit der sie den Weg zwischen Ursprung und Ziel überwinden müssen, begleitet sie oft lebenslang. Ludwig Fels hat die Welt von dieser Position aus betrachtet und sich den Willen zur Poesie bewahrt. Ulrich Breth beschreibt Leben, Werk und das nun erschienene Selbstporträt des vor vier Jahren gestorbenen Schriftstellers.
Obwohl der im Januar 2021 verstorbene Ludwig Fels ein ebenso umfangreiches wie bedeutendes literarisches Werk hinterlassen hat, das mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden ist, ist er ein Autor, der immer noch zu entdecken ist. 13 Gedichtbände, 16 Romane und Prosabücher, neun Theaterstücke und 24 Hörspiele sind zu seinen Lebzeiten erschienen. Und dennoch ist er ein Außenseiter geblieben im Literaturbetrieb, von dem er sich nicht hat vereinnahmen lassen. Vor allem aber ist er eine Ausnahmeerscheinung in der neueren deutschsprachigen Literatur. Einer, der unabhängig von Zeitströmungen und literarischen Moden über Jahrzehnte seinen eigenen, unverwechselbaren Ton geschärft hat.
Aufgewachsen ist er mit zwei Halbgeschwistern als Sohn einer alleinerziehenden Mutter in prekären Verhältnissen im mittelfränkischen Treuchtlingen, dem Heimatort, dem er in einer Art Hassliebe verbunden war. Nachdem er die ihm nach der Volksschule aufgezwungene Malerlehre abgebrochen hatte, arbeitete er, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und die Familie zu unterstützen, als Arbeiter in einer Brauerei, Maschinist, Stanzer und später, nach seiner Heirat und dem Umzug nach Nürnberg dort als Packer in einer Halbleiterfabrik. Aus seinen frühen Erfahrungen mit Armut, Gewalt, Ausbeutung und Alkohol formte er am Feierabend und an den Wochenenden Gedichte.
Wenn er als Autodidakt bezeichnet worden ist, bedeutet das, dass er einem Musiker gleicht, der nicht vom Blatt, sondern nach seinem Gehör spielt. Den Ton seiner Sprache findet er nicht, indem er sich an literarischen Vorbildern und Konventionen orientiert, sondern im Widerhall, den der Lärm der Straße in seinem Inneren hervorruft. Überhaupt ist der Einfluss der Musik, die ihm beim Schreiben stets nahe ist, nicht zu übersehen. Das gilt nicht nur für Reminiszenzen an einzelne Songs wie „Shoot The Moonlight Out“ von Garland Jeffreys (in „Ein Unding der Liebe“) oder „The First Time Ever I Saw Your Face“ von Ewan McColl (in „Reise zum Mittelpunkt des Herzens“), der vor allem in den Interpretationen von Roberta Black und Johnny Cash weltweite Bekanntheit erlangte, und Bands wie Nick Cave & The Bad Seeds und die australische Independent Rock-Group Crime & the City Solution (in „Rosen für Afrika“). Vielmehr geht es darum, dass er die Strukturen der Songs, die er hört, in den Rhythmus und das Zeitmaß seiner Lyrik und seiner Prosa überführt. Dabei ist sein musikalischer Geschmack breitgefächert, entscheidend ist die Intensität, die sich vor allem aus dem Lebensgefühl von Minderheiten an den Rändern urbaner Zentren speist, die sich in ihnen mitteilt und die er seinen eigenen Texten abverlangt.
In Besprechungen ist wiederholt zu lesen gewesen, dass sein Werk polarisiere. Mit diesem zutreffenden Befund ist wenig über dieses Werk gesagt, aber sehr viel über den Stand der Rezeption. Der Autor und Kritiker Peter Hamm hat sehr früh, in seiner Rezension des Bandes „Mein Land“ im Oktober 1978 im SPIEGEL, darauf hingewiesen, dass die Texte von Fels den Nerv des Lesers treffen, der den gesellschaftlichen Zustand der Bundesrepublik mit wachem Auge verfolgt, aber nicht den Teil der literarisch interessierten Öffentlichkeit erreicht, der sich einem kontemplativen Kunstgeschmack verpflichtet fühlt, der „auf das Seelenleben des Mittelstandes fixiert“ bleibt und dessen „Scham sich nur vor Sexuellem regt, aber nicht vor Gastarbeiter-Unterkünften, Gefängniszellen oder Politikerreden.“
Mit seinen Gedichten, in denen er in einer äußerst nuancierten expressiven Sprache private Gefühlslagen und gesellschaftliche Missstände schonungslos offenlegt, und seinen Erzählungen und Romanen, in denen er eindringliche Bilder dafür findet, wie seine Antihelden illusionslos und doch mit einer schwer zu beschreibenden Würde ihrem Untergang entgegen gehen, hat er eine Reihe von Kritikern und eine Lesergemeinde gefunden, die ihm über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Auch in den Jahren 1988 bis 2010, in denen er keine Gedichtbände publiziert hat, haben lyrische Elemente und kurze Gedichte Eingang in seine Prosa gefunden, häufig in einer den Erzählzusammenhang strukturierenden Funktion, die das Einzelschicksal der Figuren auf ein allgemeingültiges Niveau hebt. Zu seinen wichtigsten Prosaarbeiten gehören die beiden Romane „Ein Unding der Liebe“ (1981) und „Die Hottentottenwerft“ (2015) sowie der Band „Der Himmel war eine große Gegenwart“ (1990), in dem er sich mit dem Leben und Sterben seiner Mutter auseinandergesetzt hat.

Fels' größter Erfolg, der sozialkritische Roman „Ein Unding der Liebe“, erzählt die Geschichte Georg Bleisteins, eines Verlierers der Wohlstandsgesellschaft, der sich ungeliebt, fremd in der Welt und fremd im eigenen Körper fühlt. Zur großen Bekanntheit des Romans hat seine Verfilmung durch den rumänischen Regisseur Radu Gabrea beigetragen, in der der Darsteller Erich Bar in der im März 1988 als Zweiteiler im ZDF ausgestrahlten Produktion der Titelfigur eine geradezu beängstigende physische Präsenz verliehen hat. Aufgrund einer Krebsdiagnose konnte der iranische Autorenfilmer Sohrab Shahid Saless, der das Drehbuch geschrieben hatte und ursprünglich für die Regie vorgesehen war, den Film nicht realisieren. Bereits Mitte 1982 hatte er an Ludwig Fels unter dem Eindruck der Lektüre des Romans geschrieben: „Georg Bleistein ist mittlerweile ein Freund von mir geworden. Wenn es ihn friert, friere ich mit ihm. Wenn er frühmorgens zur Arbeit geht, sitze ich mit ihm im Bus und sehe seinen Nacken an. Und als er ausbricht, weiß ich, daß Bleistein und ich beide nie mehr ein Zuhause finden werden.“ Neun Jahre später konnte er mit seinem letzten Film „Rosen für Afrika“ (1991) doch noch einen Roman von Fels in die ihm eigene Filmsprache übersetzen, die in ihrem Blick auf die Verlorenheit ihrer Figuren manche Parallelen zu Fels' Poetik aufweist.
„Die Hottentottenwerft“ schildert die Schrecken der Kolonialzeit in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Reiter Crispin Mohr, der sich in Afrika, in dieser „Landschaft von sinnloser Schönheit“, eine Zukunft aufbauen möchte und scheitert, weil er dort von äußeren und inneren Dämonen heimgesucht wird. Sowohl Lothar Struck in seiner Besprechung des Romans im Magazin „Glanz und Elend“ als auch der mit Fels befreundete Autor Jan Koneffke in einer Ludwig Fels gewidmeten Veranstaltung, die im November 2022 in der Alten Schmiede in Wien stattgefunden hat, haben gezeigt, dass es in diesem Roman nicht um eine authentische Rekonstruktion des Erbes der Kolonialzeit, die fiktionalisierte Form einer postkolonialen Studie geht, sondern, wie Koneffke unter Hinweis auf seinen Aufsatz „Das fernste Bild der Heimat“ dargelegt hat, der im Mai 2017 in der Literaturzeitschrift „wespennest“ erschienen ist, um „Erfahrungen von Entfremdung und Fremdheit, fremder Heimat und fremder Fremde.“
Das Abschiedsbuch für die Mutter erinnert auf berührende, völlig unsentimentale Weise an das Leben einer Frau, in dem für sie selbst nichts übrig blieb und das eigentlich noch gar nicht begonnen hat, und für deren Tod es deswegen keinen Trost gibt. Mit minimalistischen sprachlichen Mitteln hat er diesen Verlust beschrieben. „Niemand ist auf der Straße, als sie in einen graulackierten Kombi geschoben wird. Es hätte nicht viel gefehlt, und wir hätten ihr hinterhergewunken.“
Nicht nur der Umzug nach Wien 1983 und der zwei Jahrzehnte später vollzogene Verlagswechsel haben dazu geführt, dass Ludwig Fels gelegentlich als österreichischer Schriftsteller bezeichnet wird. Es ist auch ein Ausdruck der besonderen Wertschätzung, die er in seiner Wahlheimat genießt. Die Tatsache, dass sich sein Heimatort Treuchtlingen ihrem einst ungeliebten Sohn angenähert hat, sollte dazu beitragen, dass er verstärkt auf beiden Seiten der deutsch-österreichischen Grenze als bedeutender deutschsprachiger Dichter und Schriftsteller, und als fränkischer zumal, wahrgenommen wird.
Im Mai 2023 wurde im Verlag Jung und Jung der Gedichtband „Mit mir hast du keine Chance“ veröffentlicht, eine Auswahl von Gedichten aus den Jahren 1973 bis 2018, darunter auch acht bisher unveröffentlichte, die von seiner Frau Rosy Fels und seinem Lektor Günther Eisenhuber zusammengestellt worden ist. Die Veröffentlichung des Gedichtbands erinnert daran, dass der unerhörte Ton, den Fels bei seinem literarischen Debüt 1973 angeschlagen hat, nichts von seiner elementaren Wucht verloren hat. Und sie zeigt auch, dass die Entwicklung seines vielgestaltigen lyrischen Schaffens einhergeht mit seinem Songverstehen, das er mit dem Hinweis für sich in Anspruch genommen hat, dass er von Musik mehr verstehe als von Literatur und immer auf der Suche nach dem besten, dem letzten, dem ultimativen Song gewesen ist.
Nun ist im gleichen Verlag, in dem er seit 2006 seine verlegerische Heimat gefunden hat, unter dem Titel „Ein Sonntag mit mir und Bier“ ein literarisches Selbstporträt des Autors erschienen, das auf den ersten Blick als eine Art hochironisches Scherzo daherkommt, sich aber bei näherer Betrachtung zugleich als ein vielschichtiges, hintergründiges Stück Literatur erweist.
In ihm setzt sich Fels mit Verformungen und Verkennungen seiner Wahrnehmung in der literarischen Öffentlichkeit auseinander und lässt, einer Familienaufstellung nicht ganz unähnlich, die Galerie seiner Ahnen an sich vorüberziehen. Den provisorischen Rahmen des Textes bildet ein sonntäglicher Besuch des Autors im Biergarten, bei dem er von einem Filmteam begleitet wird, dessen Regisseur sich zum Ziel gesetzt hat, ihn „ins rechte Licht zu rücken“, ihn „medial repräsentativ zu präsentieren.“ Provisorisch ist der Rahmen insofern zu nennen, als er mit einer „1. Szene“ einsetzt, die durch einen abrupten Eingriff endet und der keine weitere folgt. Ebenso im Ungefähren bleibt der Ort des Biergartens, der zwar Bezüge zum „Bratwursthäusle“ am Nürnberger Rathausplatz aufweist, aber „irgendwo im Fränkischen“ situiert ist, in der Nähe eines Ortsschilds auf dem „End“ steht. Auch der Umstand, dass der Autor in der Szene als „das ICH“ auftritt, das ein handgemaltes Pappschild um den Hals trägt, „auf dem in Großbuchstaben ICH steht“, legt nahe, dass der Leser keineswegs sicher sein kann, wen er vor sich hat. Immerhin wird durch zwei dem Selbstporträt vorangestellte Paratexte eine erste Spur gelegt, eine Erwartungshaltung des Lesers geweckt.
Da ist zunächst das Motto eines unbekannten Schriftgelehrten, bei dem es sich um eine der Masken des Autors handeln dürfte, in dem es um die Frage geht, warum der Mensch mehr trinkt, als ihm guttut. Und dann ein kurzes Vorwort, das sich als Vermeidung eines Vorworts darstellt, in dem durch den lexikalischen Hinweis, dass Arbeiter und Arsch ebenso wie Proletariat und Prekariat die gleichen beiden Anfangsbuchstaben haben, in das Milieu eingeführt wird, in das sich der Autor in seiner Doppelexistenz als Arbeiter und Dichter unfreiwillig gestellt sieht. Ausgesucht hat er sich diese Zwangslage nicht; umso weniger braucht er sie zu verleugnen. Das gilt für sein Leben als Arbeiter „in der Mitte/ zwischen arm und ärmsten“ ebenso wie dafür, dass er „ein Kleinstadtmonster und/ eine Religion für mich“ gewesen ist, wie es in einem seiner frühen Gedichte heißt. Gleiches gilt für den Dialekt seiner fränkischen Heimat, der sich im Selbstporträt gelegentlich in eruptiver Form Bahn bricht.
Für die folgende Szene gilt, dass der Dichter auch dann arbeitet, wenn er „die Sonntage mit Schlaf tötet“ oder eben mit einem Stapel Papier im Biergarten sitzt. Dabei hat er sich sowohl der äußeren Realität zu erwehren, nämlich der literarisch interessierten Öffentlichkeit, die in Gestalt der Biergartengesellschaft wiederkehrt und sich, meist störend, bemerkbar macht, als auch unbewußten Erinnerungen, die in seinem Inneren Gestalt annehmen, meist die von nahen Verwandten, ganz so, wie das auch bei einer seiner Romanfiguren, dem Pappenheimer Crispin Mohr der Fall ist. Keiner seiner Einwände und Einfälle steht für sich allein, weil er über das untrügliche Gefühl verfügt, dass alle Dinge in der Sprache der Poesie durch ein unsichtbares Netz miteinander verbunden sind. So legt die von ihm gewählte Selbstbezeichnung als „Hilfsarbeiterhilfsschriftsteller“, die er seiner Fremdbezeichnung als „Arbeiterdichter“ entgegenhält, für ihn die Vorstellung nahe, dass er im Blaumann und einem orangen Schutzhelm seine Schreibmaschine bearbeitet, was unwillkürlich das Bild von der Schreibmaschine, die er zur Axt umgebaut hat, aufruft, das er in einem seiner frühen Gedichte, „Poetenleben“, verwendet hat. Wenn ihm, der ohne Maß und Ziel trinkt, die Kellnerin eine neue Maß an den Tisch bringt und ihm dabei „ein bißchen zärtlich ihre schwielige Hand auf die Stirn legt“, dann erscheint diese Arbeiterfrau, deren Hand „noch nie ein Buch gestreichelt hat“, weil sie „tagtäglich Hektoliter Gerstensaft serviert“, als eine Schwester der Romanfigur Erika, über die es in „Ein Unding der Liebe“ heißt, „sie hätte schön sein können, wenn sie tagsüber geschont worden wäre“. Wenn er auf seine ersten Schreibversuche am heimischen Küchentisch zu sprechen kommt und dabei die 45er Single DADDY ROLLING STONE von Otis Blackwell erwähnt, die er möglicherweise in der späteren Version von The Who gekannt hat, dann lässt sich das direkt auf die vorherige Bemerkung beziehen, „Sozialwohnung, Innentoilette, kein Bad, kein Vater, kein Arsch: Arbeiterdichterbehausung für Fürsorgeempfänger!“, in der die Folgen des Umstands beschrieben werden, dass sein Vater selbst so ein rollender Stein gewesen ist, als den er ihn in seinem Buch „Der Himmel war eine große Gegenwart“ charakterisiert hat und als der er bereits zehn Seiten vorher wie aus dem Nichts im Biergarten aufgetaucht ist. Wenn er davon spricht, dass er „nach einer Weltreise durch die Arbeitswelt“ im Biergarten gelandet ist, dann bringt er damit zum Ausdruck, dass er auf dieser Reise sehr wenig von der Welt, aber sehr viel Arbeit gesehen hat.
Während der Sonntag im Biergarten sich bei Schweinshaxen und unzähligen Maß Bier in den Abend dreht, muss sich der Autor wiederholt gegen die Zudringlichkeiten anderer Gäste, darunter einen Steuerfahnder und Gerichtsvollzieher, einfallende Touristenhorden und eine sinnlos vor sich hinschunkelnden Familie, zur Wehr setzen. So etwas Ähnliches wie Rettung wird ihm dabei durch den Telefonanruf seiner Frau vom anderen Ende der Welt sowie durch die Erscheinung seines Onkels Ludwig zuteil, der wie kein zweiter Schuhplattler getanzt hat und jung gestorben ist, und schließlich durch einen Afrikaner, der sich zu ihm an den Tisch setzt und ihn mit seinem Taxi in einer nichtendenwollenden Fahrt in seinen Heimatort Treuchtlingen kutschiert. Dort trifft er nochmals auf seinen Lieblingsonkel, der mit ihm die Verhältnisse zum Tanzen bringen möchte, bevor er den Tag mit den Worten „Bin da, sage nichts.“ beschließt. Es ist der Satz, der den Regisseur zum Eingreifen zwingt, weil er den provisorischen Rahmen des Selbstporträts sprengt und in dem sich die sprachkritische Haltung des Sprachvirtuosen Ludwig Fels in einer Geste der Verweigerung zur Geltung bringt. Er misstraut dem reinen Mitteilungscharakter der Sprache. Die Sprache gehört zum menschlichen Ausdrucksverhalten und ist da, solange es Menschen gibt. „Bin da, sage nichts.“. Anders als es die schulmeisterliche Frage will, hat der Dichter im emphatischen Sinne nichts zu sagen, aber jedes Recht auf Ausdruck. Das gilt auch für Ludwig Fels, von dem André Dahlmeyer im November 2023 im ND gesagt hat, dass er zu denen gehört, die aus Notwehr schreiben. In diesem Aufsatz hat er ihn einen der nonkonformistischsten Schriftsteller der deutschsprachigen Literatur genannt, der sich nie hat vereinnahmen lassen und keine Kompromisse gemacht hat.
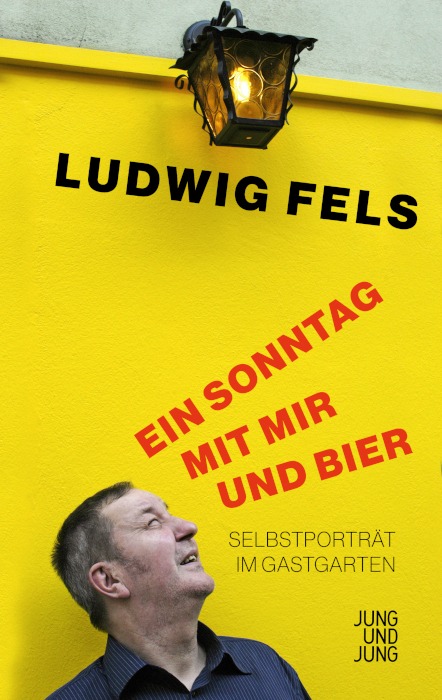
Ludwig Fels
Ein Sonntag mit mir und Bier.
Selbstporträt im Gastgarten
128 S., geb.
ISBN 978-3- 99027-414-9
Jung und Jung, Salzburg 2025
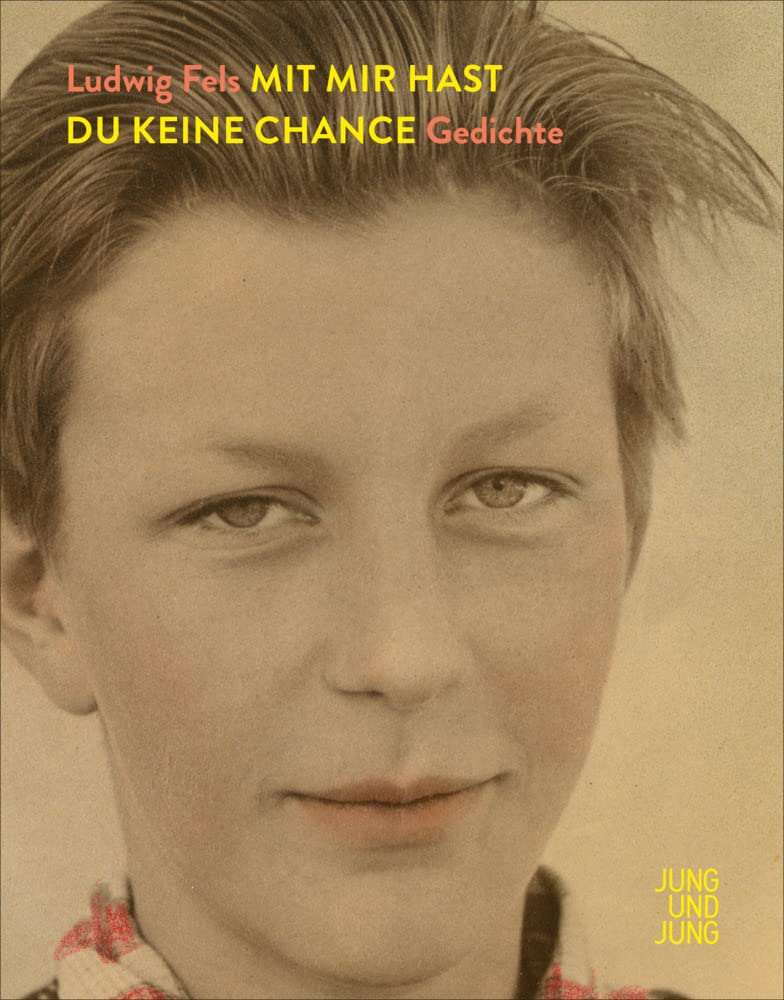
Ludwig Fels
Mit mir hast du keine Chance
Gedichte
Mit einem Vorwort von Oskar Roehler
Und einem Nachwort von Bernardette Conrad
144 S., geb.
ISBN: 978-3-99027-278-7
Jung & Jung, Salzburg 2023
Erstellungsdatum: 23.01.2025