


 MENU
MENU

Sebastian Klein ist ein Verräter seiner Klasse, um es mit einer veralteten Vokabel auszudrücken. Als einstiger Superreicher schreibt er ein Buch über Superreiche und legt darin den Kapitalvermehrungs- und Steuervermeidungsmechanismus offen, der die Verarmung der Nichtreichen und politische Verwerfungen zur Folge hat. Ob dieses Gebaren legal ist, hängt offenbar vom Kalkül der politischen Entscheider ab. P H Gruner schätzt das Buch und kritisiert es.
„Deutschland hat 500 Superreiche mehr“, meldet Ende Juni „tagesschau.de“. Innerhalb nur eines Jahres stieg die Zahl von Deutschen mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen um 500 Personen und damit um satte 16 Prozent – dies inmitten und trotz aller geopolitischen und wirtschaftspolitischen Verwerfungen rund um die Kriege in der Ukraine, in Gaza und im Iran und rund um die katastrophisch hektische Volatilität der Politik von MAGA, Musk und Trump. Die nun insgesamt rund 3900 „Superreichen“ in Deutschland besitzen laut des Global Wealth Reports 2025 der „Boston Consulting Group“ zusammen knapp drei Billionen Dollar und damit rund 27 Prozent des gesamten Finanzvermögens in Deutschland.
Diese jüngste Meldung zur Vermögensvermehrung ist Wasser auf die Mühlen der Erkenntnisse, die Sebastian Klein in seinem Buch „Toxisch reich“ zusammenträgt. Die Vermögensvermehrung geschieht zudem extrem selektiv: Die Allerreichsten werden am allerschnellsten reicher. Wer bereits viel akkumuliert hat, erntet die höchsten Zuwächse. Deutsche Milliardäre profitieren dabei überdurchschnittlich stark von Erbschaften: 71 Prozent ihres Vermögens sind nicht erwirtschaftet, sondern geerbt. Weltweit liegt dieser Anteil „nur“ bei 36 Prozent.

Der Autor Sebastian Klein (Jahrgang 1982) hat bei der Betrachtung des global gigantischen Problems, das mit dem Themenfeld Ungleichheit, Armut und Ausbeutung engmaschig verknüpft ist, einen relevanten Vorteil: Er selbst war „einmal Teil dieses Problems: Ich gehörte zum reichsten Prozent der Deutschen“. Und daß der spätere Unternehmensgründer und Unternehmensberater einst Psychologie studierte im hessischen Marburg, hat bei der kritischen Durchdringung des eigenen Denkens und Handelns sowie der finanzkapitalistischen Strukturen, Möglichkeiten und Gefährdungen sicher auch geholfen.
„Blinkist“ heißt die simple, für viele nützliche und höchst erfolgreich Idee, die sich Klein und drei Studienfreunde ausgedacht hatten. Der größtenteils kostenpflichtige Abo-Service mit Sitz in Berlin, der Sachbücher und Podcasts auf Englisch, Deutsch und Spanisch in wenigen Kernaussagen zusammenfasst, hat rund 33 Millionen Nutzer weltweit. Mit Anfang 30, dem hektischen Leben als Start-up-Gründer überdrüssig, verlässt Klein seine Firma, behält aber Unternehmensanteile, weil die immer wertvoller werden und ein feines Leben ohne Arbeit ermöglichen. Beim Verkauf von „Blinkist“ sind Kleins restliche Firmenanteile dann bereits fünf Millionen Euro wert. Er gibt 90 Prozent seines Privatvermögens auf, weil er mit dem verbliebenen zehn Prozent über ausreichend Kapital verfügt und längst weiß, daß er und seinesgleichen Teil des globalen Ungleichheitsproblems sind.
Letztlich schreibt er darüber. Und definiert korrekterweise Ungleichheit als ademokratischen Fakt. Es geht dabei nicht um Einkommen. Es geht um Vermögen. Viel Vermögen setzt sich um in viel Einfluss und viel Macht. Letzlich hebelt persönlicher Einfluss qua Vermögen den alten Grundsatz der egalitären Partizipation im gesellschaftlichen Prozess – Ein Mensch, eine Stimme – komplett aus. Es wird ersetzt durch das Prinzip Ein Euro, eine Stimme. Hochvermögende gestalten so ihr Lebens- und Rendite-Umfeld nach eigenen Schwerpunkten. Sie unterstützen politische Köpfe nach Gusto, sie spenden für Parteien, bis diese hohl und abhängig werden, sie kaufen Medien und senden selbst, sie deformieren den Wahlprozess, sie unterminieren die Pressefreiheit, die Vielfalt des Diskurses, die demokratische Kultur, sie lenken mit „Beratung“, mit scheinbarer Expertise Staat und Wirtschaft. „Toxisch“ werden Hochvermögende also durch die angelegte autokratische Kraft der Möglichkeiten, die sich ihnen eröffnen. Es ist eine Verführung. Ikonisches Beispiel im Ausland ist der US-Unternehmer Elon Musk. Tesla Inc. hat er nicht gegründet, sondern zu seinem Kernunternehmen gemacht, Twitter hat er gekauft und als X zum persönlichen Einfluss-Werkzeug missbraucht. Den Präsidentschaftskandidaten aus dem Immobilien-Kapital (Donald Trump) hat er bei dessen Übernahme erst der Partei der Republikaner und dann des gesamten Landes mehrfach rhetorisch, strukturell, neoliberal-ideell und nicht zuletzt finanziell (mit 250 Millionen Dollar) unterstützt. Gelandet ist er als Nichtgewählter dicht neben dem gewählten Präsidenten im Weißen Haus. Musk ist der Prototyp jener Vermögens-Oligarchie, die sich als Retter geriert, die Partizipation breiter Bevölkerungsgruppen beiseiteschiebt und im Konzert der Gleichen – ob aus Venezuela, Russland oder West-Europa – beispielsweise das Bergdorf Davos beim sogenannten „Weltwirtschaftsforum“ in Besitz nimmt und die Eigennutz-Debatte ganz unverhohlen auf offener Bühne dominiert.
Klein blickt jedoch analytisch konsequent auf den Problemort Deutschland. „In Deutschland sind die meisten Vermögen nicht erarbeitet, sondern ererbt“, manche seit 150 Jahren von Generation zu Generation, lautet sein Fazit. Mit „Leistungsträgern“ habe das nichts zu tun, bestätigt werde aber die Wirkkraft des Märchens von der „Leistungsgesellschaft“. Klein verweist auf die vielen legalen Tricks, mit denen Reiche ihr Vermögen an der Erbschaftssteuer vorbeischleusen, die als rechtliche Konstruktion untauglich, löchrig und zahnlos existiert. Die prominenten „Verschonungsbedarfsfälle“ sind eher Kabarett nach dem alten Zitat von Peter Ustinov: „Die Welt ist bereits 100 Prozent Satire. Satiriker können nur noch Witze über Witze machen.“ Dabei ist in Sachen Steuergerechtigkeit gar nichts mehr „witzig“: „Dem deutschen Staat entgehen jedes Jahr durch Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung zwischen 50 und 100 Milliarden Euro.“ Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Gewerbekapitalsteuer oder Vermögenssteuer: In Deutschland sind dies allemal untaugliche, abgeschaffte oder ausgesetzte Instrumente einer sozioökonomischen „Steuerung“ von Vermögenskonzentration. Selbst ein Steuersatz von nur einem Prozent Vermögenssteuer, „würde allein in Deutschland über 70 Milliarden Euro in die Kassen spülen.“ Ein Prozent? Müsste verkraftbar sein.
Wie kommt es zum zahnlosen Staat? Die politischen Aushandlungsprozesse zur Gestaltung von Steuern sind durch Lobbyisten aus Finanzkapital und Industrie massiv beeinflusst. Nicht zuletzt durch die rührige „Stiftung der Familienunternehmen“, die nach Gemeinnützigkeit und Mittelstand klingt, tatsächlich aber als gut getarnter Interessenverband der Milliardärsfamilien wirkt und, so Klein, eigentlich „Lobbyverband deutscher Oligarch:innen“ heißen müsste. Klein nimmt kurz und klar auch Interessenvertreter des „Bundes der Steuerzahler“, die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ oder den Verein „Die Familienunternehmer“ auseinander. Er schaut hinter die neutralen Etiketten und entdeckt stets dieselbe „gefährliche Liaison zwischen Politik und Überreichen-Lobby“.
Mit Kapiteln wie „Ungleichheit ist kein Naturgesetz“, „Ungleichheit ist schlecht für Wirtschaft“ oder „Ungleichheit macht Politikverdrossenheit und ist gefährlich“, kommt politisch-moralischer Schwung in die Schrift: „Es gibt Anwälte und Unternehmensberater, die 800 Euro die Stunde abrechnen. Für 800 Euro muss man 10 000 Glaspfandflaschen sammeln.“ Damit ist der Übergang zur Jetzt-Zeit markiert in einer deutschen Gesellschaft, die nicht nur im Osten dafür sorgt, dem System als Ganzem zu misstrauen und im Gefolge angestauter Politikverdrossenheit den Verführern populistischer Parteien von Rechts und Links die Stimme zu geben. Extrem ungleiche Gesellschaften schaffen also über Unzufriedenheit, über sicht- und erlebbare Ungerechtigkeit jenen Hang zum Extremismus, der final das gesamte demokratische Konstrukt hintertreibt. Das Zersetzen einer demokratischen Identität im Lande, darf man, wie Klein, dann durchaus plakativ zuspitzen: „Während die fünf reichsten Deutschen ihr Vermögen in wenigen Jahren fast verdoppeln konnten, durchwühlen allein in Berlin täglich Tausende Menschen in der Hoffnung auf ein paar mickrige Cent die Mülleimer der Stadt.“
Genau das macht das Buch mit seinem visuell schreiend rosafarbenen Cover zum wertvollen Beitrag: Es reproduziert nicht nur das, was seit zwanzig Jahren schon mit stets schriller intonierendem Alarmismus über die Reichtumsexplosion geschrieben und geforscht wird, sondern bezieht dies sofort auf das Schicksal des politischen Systems vor der Haustür. Jedoch: Schon vor 13 Jahren etwa hielt der „Stern“ (13/2012) über die Umverteilung von unten nach oben fest: „Ein Prozent der Gesellschaft besitzt mehr als die ärmeren 90 Prozent. Das sind die Zahlen für Deutschland, nicht für Indien oder Nigeria.“ Und über Deutschland als „Steuerparadies für Überreiche und Multimillionäre“, darüber berichtet jede Gewerkschaftszeitung ebenfalls regelmäßig seit der Jahrtausendwende.
Nichts Neues also. Durchaus. Aber dramatischer denn je, weil die Systemfrage sich stellt in weltweit fast allen Demokratien. Was das Lesen der Schrift von Sebastian Klein zum geringeren Vergnügen macht, sind inhaltliche wie formale Redundanzen, die alle dreißig Seiten zum selben Urteil kommen. Das beschert Wiedersehenserlebnisse, sicher, aber ein gutes Lektorat hätte hier argumentative Kohärenz und Effektivität hergestellt. Und wer sich wie Sebastian Klein so häufig auf eine bestimmte Schrift aus der Wirtschaftswissenschaft stützt und bezieht – „Kapital und Ideologie“ des Pariser Ökonomen Thomas Piketty (2022) –, der fördert den Gedanken beim Leser, ob man sich nicht gleich, ohne Umweg, dieser Schrift widmen sollte. Oder bei „Blinkist“ die Zusammenfassung liest. Wer zudem das allseits woke Gendern im Buch und dessen Inkonsequenzen erträgt – „jede:r ist sich selbst der:die Nächste“, „Scharfschütz:innen“ usf. –, der wird zum Schluss belohnt mit einem „optimistischen Ausblick“, gar einem idealistischen: „Wenn alles gut geht, wird sich die Menschheit emanzipiert haben und die Wirtschaft zu einem Werkzeug gemacht haben, um Gemeinwohl zu erzeugen“ und eben nicht: Renditenrekorde für wenige.
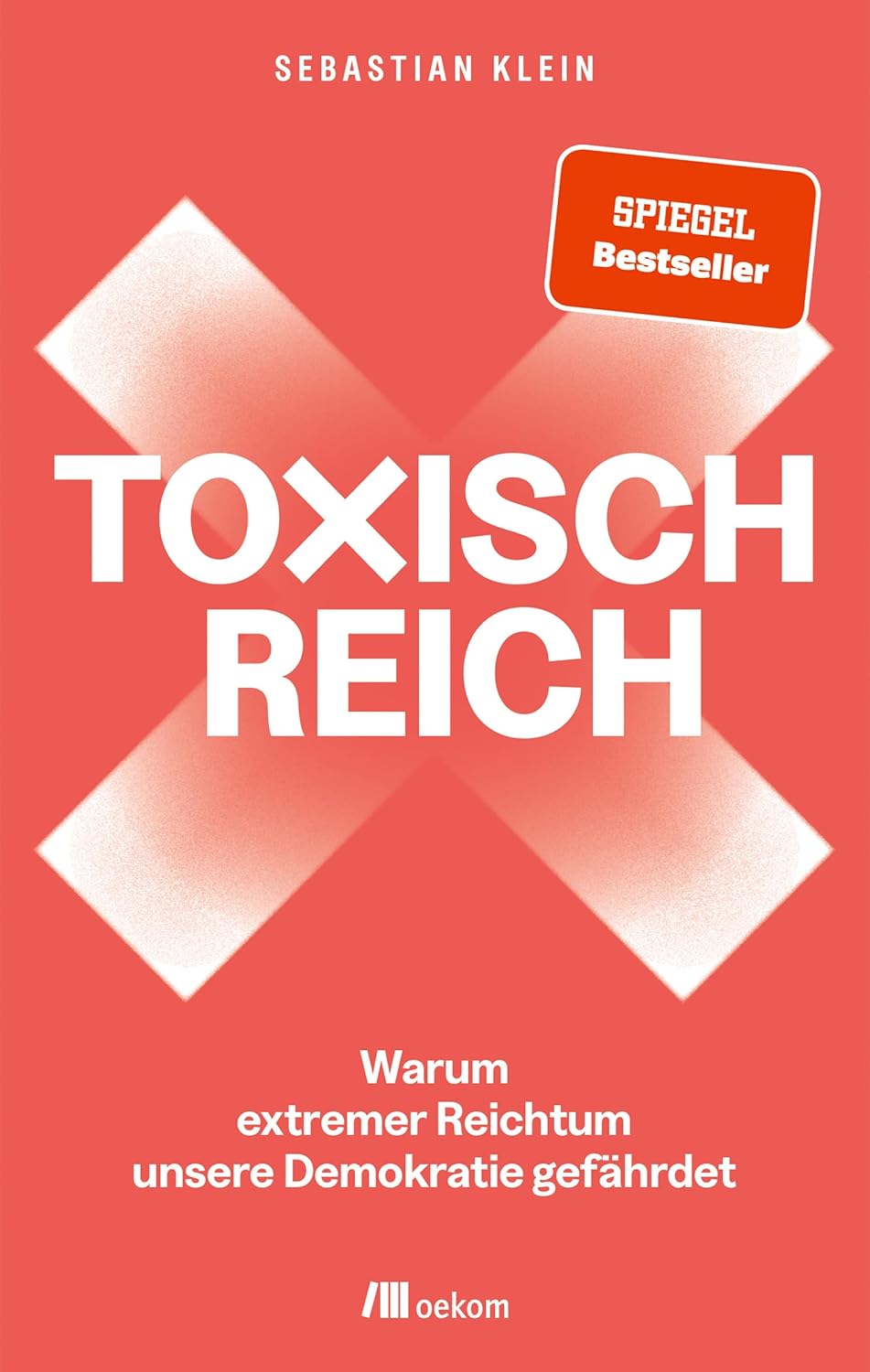
Sebastian Klein
Toxisch reich
Warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet
208 S., brosch.
ISBN: 978-3-98726-138-1
oekom-Verlag, München 2025
Bestellen
Erstellungsdatum: 22.07.2025