


 MENU
MENU

Man mag das Hochdeutsche als Gleichmacherei betrachten, was es im Sinne einer gemeinsamen Verständigung auch ist. Dabei muss man beiseite schieben, dass es einen dynamischen Reichtum an Nuancen und Kombinationen besitzt. Die Dialekte und Mundarten, wie grenzüberschreitend sie sich auch wandeln, weisen dagegen einen traditionellen, oft exklusiven Charakter auf. Sich damit zu beschäftigen, ist reizvoll und vergnüglich. PH Gruner hat sich an Frank Winters „Badisch“ erfreut.
Mundart, Mentalität und Identität bilden nicht selten eine direkt aufeinander bezogene Einheit. Daher werden Sprachführer gerne auch zu Kulturführern. Im vorliegenden Falle will der Autor Frank Winter das auch gar nicht verstecken. Nein, der gebürtige Karlsruher serviert mit Stolz und stets dezent geführtem Witz seine Einführung ins Badische auch als Beweisführung für regionalen Patriotismus.
Dabei ist das in einem Bundesland mit Bindestrich (seit 1952 gibt es Baden-Württemberg) gar nicht so leicht. Dass der Bindestrich auch als Trennungsstrich verstanden wurde und wird, liegt auf der Hand. Dennoch ist da was zusammengewachsen. Man könnte die Verbindung von Badenern und Schwaben heute daher auch beschreiben als vernunftorientierte „Koexischdenz“.
Wenn etwas relativ ist, dann sind es dialektale Färbungen. Die Sprachräume Baden-Württembergs sind bereits intern eine eigene Abhandlung wert, aufgezählt von Nord nach Süd: Rheinfränkisch, Unterfränkisch, Süd- und Ostfränkisch, Westschwäbisch, Zentral-, Nordost-, Mittelost- und Südschwäbisch, Oberrhein-Alemannisch, Hochalemannisch sowie Bodensee- und Schwäbisch-Alemannisch, nicht zu vergessen, rund um Leutkirch: West-Allgäuisch.
Und extern? Da können wir vermerken, dass die Übergänge zum Rheinhessischen und Südhessischen, zum Bayrisch-Schwäbischen, zum Elsässischen und Französischen und Schweizerisch-Alemannischen niemals ausgeblendet werden können. Und Liechtenstein und Österreich? Nein, an dieser Stelle machen wir mal einen Schnitt.
Wissenschaftlich dürfte man auch nicht über Badisch schreiben, sondern eher über Südfränkisch, mit der alten Hauptstadt des Großherzogtums Baden in der Mitte: Karlsruhe.
Weil alles jedoch mit allzu Vielem zusammenhängt, geht Winter konsequent und zeitsparend hinüber ins alltägliche Dialektsprechen, eingeteilt stets in Badens „Norden“ und Süden“. Diese Unterteilung geht durch alle Listen und Tabellen, die der Autor mag, hindurch. Sie halten seinen Sprachführer flüssig, flott, smart und luzide. Dadurch werden direkte Vergleiche möglich, also der Blick auf jene oft nur scheinbar marginalen Abweichungen, auf die es ankommt. Etwa beim Küchen-Badisch. Zum Beispiel beim Rest vom Apfel („Apfelbutze“ oder „Epfelbutzge“), beim Feldsalat („Aggersalat“ oder „Sunnewirbili“) und bei der Zwetschge („Gwetsch“ oder Zwätschge“).
Der Kultur des Zischlautes sind zum Glück mehrere Seiten gewidmet. Das hat er verdient. Es zischt in Baden nämlich gewaltig, ganze Sätze verzischen in einem Wort: „Sischäbisslfrisch“ (Es ist ein wenig kühl), „Scheeischscho“ (Schön ist es schon) oder „So machschs!“ (So solltest du es machen). Allerdings wird in diesem Sch-Kapitel auch deutlich, dass sich Menschen in Schwaben, Hessen oder im Allgäu fast nahtlos von vielen Beispielen mit angesprochen fühlen dürfen, also von einem badischen Alleinstellungsmerkmal keineswegs auszugehen ist. Scheinbare Einwort-Sätze, besser: charakteristisch verknüpfte Silbenhaufen wie „Händahändelmitnanna?“ (Habt ihr Streit?) oder „Dummeldejetzawamol!“ (Beeil dich jetzt aber mal) könnte leger auch das Sprechen etwa in der Pfalz bieten. Die im Badischen irreguläre Verwendung des Wörtchens „als“ gemahnt teuflisch an jene in Hessen. Das Badische „Ich ess als gern Nudle“ (Ich esse immer wieder gerne Nudeln) erinnert ans hessische Kommando „Als ford!“ (Immer weiter, nicht stehenbleiben).
Wird im Englischen der Satzbau mit dem Hilfsverb to do ermöglicht, so ist im gesamten Baden-Württemberg, also bei Badenern wie bei Schwaben, das Hilfverb „tun“ ebenfalls reichhaltig vorhanden. „Du dusch trödle“ heißt es, nicht Du lässt dir zuviel Zeit. „Dusch wische?“ wird gefragt. „Du dusch viel vergesse“ wird festgestellt. Wäre aber auf der Schwäbischen Alb kaum anders. Modalverben bekommen den badischen Vokal spendiert, ein Extra für die typische Klangfärbung, also statt Ich darf „I därf“ und im Plural „Ihr därfet“.
Größere, sehr interessante Unterschiede präsentiert die Tabelle bei den Wochentagen. Im Süden sind Montag und Dienstag „Mändig“ und „Zischdig“, im Norden „Mondag“ und „Dinschdag“. Donnerstag und Freitag heißen im Süden Badens „Dunschdig“ und „Friddig“.
Ein Buch zum Blättern und Staunen, zum Schmunzeln und Ablachen, das ist Frank Winter mit „Badisch“ gelungen. Letztendlich ist es auch ein Buch fürs entdeckende Verstehen tieferer Zusammenhänge – zum großen Glück auch ohne zu starken linguistischen Impetus. Und für fundierte Kenner ist es ein Buch, das ein Phänomen mitten im schon jahrzehntealten Sinkflug seiner Bedeutung beschreibt. Der Trend ist eindeutig, deutschlandweit, gießt also kein Wasser einzig in den herausragenden badischen Wein, sprich: „Wei“ (Norden) oder „Wii“ (Süden). Ja, Dialekte lösen sich auf. Ende September 2024 wurde erstmals der „Tag der kölschen Sprache“ gefeiert. Ein Verzweiflungsakt. Kaum jemand kann noch echtes Kölsch, klagt Günther Lückerath, Gründungsmitglied der berühmten Kölner Mundart-Kultband Bläck Fööss. Ein Tag der kölschen Sprache wird diesen Dia- und Soziolekt also nicht retten.
Das Institut für deutsche Sprache (im badischen Mannheim!) misst regelmäßig den „Abwärtstrend“ aller deutschen Mundarten. Nurmehr zwei Fünftel der Deutschen spreche, mehr oder minder, einen Dialekt. Der Niedergang ist wahrlich keine Neuigkeit, aber er geht eben stets weiter nieder von schon jeweils niedrigerem Ausgangsniveau. 73 Prozent der Befragten, meldet die Süddeutsche Zeitung frohgemut, schätzten die Vielfalt der deutschen Dialekte. Klingt gut. Ist aber Theorie. Auf der Zunge liegt jüngeren Deutschen ganz anderes. Wie warb 2021 das Land Baden-Württemberg für sich, betont frisch? So: „The Länd“.
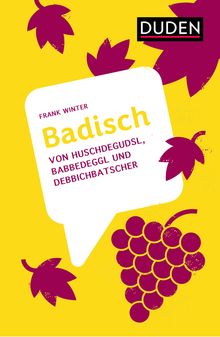
Frank Winter
Badisch
Von Huschdegudsl, Babbedeggl und Debbichbatscher
128 S., geb.
ISBN-13: 9783411756865
Bibliograph. Institut, Berlin 2024
Erstellungsdatum: 18.12.2024