


 MENU
MENU

Wer Öl ins Feuer gießt, entfacht bewusst einen noch größeren Brand. Die Journalistin Kathrin Hartmann analysiert – von den USA über Rügen bis Namibia – weltweit Projekte, die „global und gerecht“ aus Krisen herausführen sollen. Im Austausch mit Insidern vor Ort werden erschütternde Kontinuitäten einer profitgetriebenen Zerstörung erkennbar. Sachlich und einfühlsam zugleich beschreibt die Autorin die widersprüchlichen Effekte ökonomischer und technologischer Maßnahmen auf Mensch und Umwelt. Andrea Pollmeier hat mit der Autorin über ihre Recherchen gesprochen.
Andrea Pollmeier: Wer die Welt „global und gerecht“ gestalten will, muss neue Wege gehen. In Ihrem Buch „Öl ins Feuer“ untersuchen Sie Projekte, die den Klimaschutz voranbringen wollen. De facto, so zeigen Sie anhand erschreckender Beispiele, erweist sich der Klimaretter oft als Klimazerstörer. Für Ihre Recherchen sind Sie in den Süden der USA unter anderem nach Port Arthur gereist. Wie kam es dazu?
Kathrin Hartmann: Ich bin an die Golfküste gefahren, nach Texas und Louisiana,weil dort die Frontlinie der Klimakrise in den USA verläuft. Es gibt hier immer mehr extreme Hurricans, gleichzeitig wächst die petrochemische Industrie und es sind zwei Dutzend Flüssiggas-Exportterminals geplant. Das Ausmaß an Umweltrassismus und sozialer Ungerechtigkeit ist so groß, wie man es vor allem aus dem Globalen Süden kennt. Die Folgen des Wirtschaftens lagern Industrieländer dorthin aus. Aber an der Golfküste ist dieses „außen“ in den Communities, die direkt an diese Anlagen grenzen. Dort wohnen vor allem People of Color und Schwarze Menschen. In Port Arthur kann man das besonders deutlich sehen: Dort gibt es die größte Konzentration an Ölraffinerien in den USA und mehr als ein Dutzend petrochemischer Fabriken.
Sie bezeichnen diese Region als „Sacrified Zone“.
Dieser Begriff beschreibt Orte, an denen Umweltverschmutzung so extrem ist, dass die Menschen stark beeinträchtigt sind. Port Arthur in Texas gehört zu den 50 schmutzigsten Orten der Welt. Die Krebsrate dort ist um 15 Prozent höher als im texanischen Durchschnitt. Die dort angesiedelte Industrie verfolgt ein lebensvernichtendes Geschäftsmodell und es ist kein Zufall, dass sie sich in Gebieten niederlässt, wo Menschen leben, die sowieso schon benachteiligt sind. Konzerne müssen dort meist nicht damit rechnen, dass sich jemand wehrt. Es entstehen Opferzonen. Das gilt vor allem für die „cancer alley“ (Krebs-Allee) am Mississippi in Louisiana. Dort stehen auf 140 Kilometern 200 petrochemische Fabriken und Raffinerien. Bis ins 19. Jahrhundert gab es hier Zuckerrohrplantagen, auf denen Versklavten ausgebeutet wurden. Heute stehen auf diesen Flächen hier die Chemiefabriken. Sacrified Zones haben hiereine zynische Tradition.
Bleiben wird noch etwas in den USA. Es gab auch schon unter Joe Biden, den man auch als „Klimapräsident“ bezeichnet hat, gegen das Klima gerichtete Entscheidungen.
Dramatisch ist, dass unter Biden so viel Öl gefördert wurde, wie nie zuvor in den USA. Er wollte die Benzinpreise niedrig halten, damit Trump die Präsidentschaftswahl nicht erneutgewinnt. Aber auch die Entscheidung, 30 Jahre Ölförderung durch das Willow-Projekt im Nordwesten Alaskas zu erlauben, geht auf Biden zurück. Außerdem ging mit dem Inflation Reduction Act fast die Hälfte des öffentlichen Geldesin Scheinlösungen. Zum Beispiel in das Abscheiden und Speichern von CO2. Das ist aber in Wahrheit ein Rettungsring für die Ölindustrie, denn sie verwenden dieses abgespaltene CO2, um es in Reservoirs zu pumpen und die Ölausbeute zu steigern. „Emissionsarmes Öl“ heißt das dann.
Gibt es überhaupt „Grünen Kapitalismus“?
Nein, Grünen Kapitalismus kann es nicht geben! Um wirklich die Emissionen zu reduzieren, dürften einige Dinge nicht mehr oder nur sehr viel weniger hergestellt werden. Aber diese Diskussionen gibt es gar nicht. Der grüne Kapitalismus suggeriert, es könne alles weitergehen wie bisher und wir könnten die Klimakrise technologisch lösen. Die Rede ist ja auch gar nicht mehr von der Vermeidung von CO2, es heißt jetzt Carbon Management. Dazu gehört auch Carbon Capture and Storage (CCS): CO2 soll bei Produktionsprozessen abgeschieden und unter dem Meer verpresst werden. Aber bislang sind 80 Prozent der Projekte gescheitert, und schwere Pannen gab es überall. Der freiwillige Zertifikatehandel hat sich als Greenwashing entpuppt, die Bepreisung von CO2 hat bisher nirgendwo beigetragen, die Emissionen ausreichend zu senken. Grünes Wachstum gibt es nicht, es werden immer Rohstoffe und Energie verbraucht.
Können Sie das konkreter beschreiben?
Es würden deutlich weniger Rohstoffe gebraucht, wenn weniger und kleinere e-Autos gebaut würden und deutlich mehr Metalle recycelt würden. Doch die Autoindustrie setzt auf dicke, schwere elektro-SUVs. Damit ist für das Klima fast nichts gewonnen, weil diese Wagen in Herstellung und Verbrauch einen großen Rohstoff- und Energieverbrauch haben. Es zeigt, dass durch diese Art des Grünen Kapitalismus nichts anders wird. SUVs lassen die Kassen von Konzernen klingeln, sie treiben die Profite in die Höhe. Man setzt, wie VW zeigt, auch auf Kosten der Belegschaft weiter auf e-SUVs, um das erwartete Profit- und Renditeziel nicht zu beeinträchtigen: Man braucht dafür nicht mehr so viele Arbeitende. Ein anderes Beispiel ist das Versprechen vom Grünen Wasserstoff, der in besonders energieintensiven Industrien zum Einsatz kommen soll, etwa bei der Produktion von Stahl und Zement. Aber das ist bislang nur Phantasie: weniger als ein Prozent des global hergestellten Wasserstoff ist grün, also mit erneuerbarer Energie hergestellt. Die Herstellung braucht sehr viel Energie und Wasser. Die Bundesregierung hat schon angekündigt, mehr als 70 Prozent importieren zu wollen. Zum Beispiel aus Namibia, wo gerade eine solche Anlage gebaut wird – in einem Naturschutzgebiet. Aber wenn der Ökostrom für die Herstellung von Wasserstoff zum Export produziert wird, fehlt er den Menschen vor Ort.
Das bedeutet, wir setzen ein System der sozialen Ungerechtigkeit fort, das strukturell seit der Kolonialzeit besteht?
Ja, exakt. Wir müssen uns nur den Abbau von Rohstoffen anschauen, der für e-Mobilität notwendig ist. Es ist hinreichend bekannt, dass der Abbau von Nickel, Lithium und Aluminium mit Landkonflikten und Menschenrechtsverletzungen einhergeht. Es tauschen sich nur die Rohstoffe aus, das Prinzip bleibt das Gleiche. Der in Wien lehrende Politikwissenschaftler Ulrich Brand spricht von„Grünem Extraktivismus“. Die neuen Technologien ersetzen nämlich noch gar nichts, sie kommen zusätzlich obendrauf. Weil es weiterhin Autos mit Verbrennermotoren gibt, werden weiterhin „alte“ Rohstoffe gefördert, jetzt kommen„Transformationsrohstoffe“. So nennt sie die Industrie, aber das ist reines Greenwashing, denn die Transformation findet ja gar nicht statt. Wir müssen die Diskussion führen, was wir von all dem, woran wir festhalten, wirklich brauchen. Grüner Kapitalismus verhindert jedoch diese Diskussion. Am Ende haben wir eine klimaneutrale Klimakatastrophe, weil auf dem Papier die CO2-Bilanzen stimmen. Auf die Folgen dieser Krise sind wir aber überhaupt nicht vorbereitet, alle politische Anstrengung gilt dem Systemerhalt.
Woran kann man sich positiv orientieren?
Es gibt viele wegweisende Kämpfe und Konzepte, die die ökologischen und die sozialen Fragen miteinander verbinden. Wir alle brauchen Zugang zu Gesundheit, eine gute Daseinsvorsorge, soziale Sicherheit und eine öffentliche Mobilität, die für jeden leistbar und erreichbar ist. Aber wir haben uns von denjenigen, die von den bestehenden Verhältnissen profitieren, ein völlig falsches Freiheitsbild in Gestalt von dicken Autos, Individualverkehr, vielen Flugreisen und möglichst viel Privatbesitz einreden lassen. Aus diesem Stockholmsyndrom müssen wir uns befreien.
Gibt es konkrete, zukunftsweisende Erfahrungen, wo solche Initiativen Wirkung entfaltet haben?
Ein Beispiel, das mich bis heute fasziniert, ist die griechische Solidaritätsbewegung, die aufgrund der Finanzkrise 2008entstanden ist. Damals wurde in kurzer Zeit ein solidarisches Netzwerk gegründet, das die Menschen in ihrem Alltag unterstützen sollte. Solidarische Kliniken, in denen Ärzte kostenlos viele tausend Menschen versorgten, die mit ihrem Job ihre Krankenversicherung verloren haben und lebensnotwendige Behandlungen abbrechen mussten. Dazu gehörten auch solidarische Apotheken, die Medikamente zum Allgemeingut gemacht haben. Es gab für alle Grundbedürfnisse solche Strukturen mit dem Ziel, die Menschen wieder zu befähigen, politisch aktiv zu werden. Auch an der Golfküste in den USA hat sich eine Graswurzelbewegung gegen die fossile Industrie und die LNG-Terminals entwickelt. Der Protest kam nicht von großen Umweltorganisationen, sondern von Menschen, die in der Ölindustrie gearbeitet haben und die die Missstände in ihrer Region ursächlich bekämpfen wollen.
Gibt es weitere Beispiele auch für den industriellen Kontext?
Es gibt bereits Industriebetriebe in der Hand der Arbeiterinnenund Arbeiter, die nun nachhaltige Dinge produzieren. In Südfrankreich gibt es Scop TI, die stellen aus lokal geernteten Lindenblüten Tee her, in Thessaloniki ist die Fabrik Vio.me besetztworden und produziert heute umweltfreundliche Reinigungsmittel, in Florenz ist der Autozulieferer GKN ebenfalls in Arbeiterhand, dort werden jetzt statt Autoteilen für Ferrari und Co Lastenfahrräder hergestellt und womöglich auch bald Solarmodule. GKN hat großen Rückhalt in der Bevölkerung und viel Geld über Crowdfunding zur Verwirklichung bekommen. In Wolfsburg gab es zwei Jahre lang das aktivistische Projekt Verkehrswendestadt Wolfsburg. Unter dem Motto „VW heißt Verkehrswende“ kämpften sie dafür, dass der Konzern die Produktion auf Straßenbahnen,Busse und Lastenfahrräder umstellt. Bei den Beschäftigten gab es da durchaus Interesse. Es ging ja immer um beides, ökologisch und sozial: Die Aktivisten sagten ihnen, ihr werdet weiterhin gebraucht und so könnt ihr Eure Arbeit behalten. Konversion geht also, wenn man das möchte. Während der Pandemie hat Seat etwa von einem Tag auf den anderen Atemgeräte hergestellt. Solche echten Alternativen müssen wir diskutieren, die Vorstellung eines Grünen Kapitalismus verhindert das jedoch.
Blockiert Freihandel ebenfalls eine solche Weiterentwicklung?
Freihandel geht immer einher mit einer Entrechtung der Zivilgesellschaft. Konzernen werden Sonderrechte eingeräumt, es gibt damit eng verbunden eine Schattenjustiz. Das Pendant zum Freihandel ist das Lieferkettengesetz, doch dagegen gehen viele Unternehmen und ihre Verbände auf die Barrikaden. Auf der Basis von Freihandelsabkommen können Unternehmen ganze Staaten verklagen, wenn ihnen aufgrund von Menschenrechts- und Umweltmaßnahmen ihre erwarteten Gewinne ausbleiben, während aber andersherum Betroffene keinen Konzern wegen Menschenrechtsverletzung oder Umweltzerstörung verklagen können. Oder jedenfalls nur extrem schwer.
Es ist also noch schwerer, sich durchzusetzen, wenn es Handels- und Rohstoffabkommen gibt; der rechtliche Spielraum der regionalen Bevölkerung vor Ort, „Nein“ zu sagen, wird – wie das Mercosur-Abkommen zeigt – eingeschränkt. Freihandel ist also ein extremer Treiber von ungerechten Entwicklungen.
Wenn Sie herausragende Merkmale nennen sollen, die eine gerechte und globale Welt kennzeichnen, welche sind dies?
Man muss vom Gerechtigkeitsgedanken ausgehen und das Soziale an die allererste Stelle setzen. Es gilt, permanentes Angstmachen zu durchbrechen, wenn zum Beispiel mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gedroht wird. Nachdem das Verwaltungsgericht entschieden hatte, dass der Hambacher Forst nicht abgeholzt werden darf, hat RWE beispielsweisesofort mit Stellenabbau gedroht. Damit werden ständig Arbeitende gegen Klimaschützer*innen ausgespielt.
Wenn es eine gute Daseinsvorsorge gibt, wenn Miete und Mobilität bezahlbar sind, wenn wir Arbeit teilen, wenn wir in solidarischer Landwirtschaft selbst darüber bestimmen, wie Essen produziert wird und Produzenten und Konsumenten gemeinsam faire Preise dafür aushandeln, wenn wir eine Konversion und Vergesellschaftung der Industrie hinbekommen – dann haben wir erstens den Rücken frei, um für unsere Rechte und Klimaschutz zu kämpfen; und außerdem können uns Konzerne nicht mehr zum Zwecke ihres Profits erpressen und in Panik versetzen. Das würde ich mir wünschen.
Das Interview ist erstmals in der Frankfurter Rundschau am 7. März 2025 erschienen.
Kathrin Hartmann war Teilnehmerin einer Veranstaltung über Alternativen zum neuen Autoritarismus, die unter dem Titel „Global und gerecht – Wege aus einer Ökonomie der Ungleichheit“ im Mousonturm am 11. März im Künstler*innenhaus Mousonturm stattgefunden hat. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Demokratie global“, die der Verein Transnationale Demokratie e.V. organisiert. Die Reihe wird mit einem Symposium zum Thema „Demokratie und Autoritarismus“ am 25.-26. April im Offenen Haus der Kulturen im Studierendenhaus Frankfurt bei freiem Eintritt fortgesetzt. Programm und Anmeldung unter https://transnationale-demokratie.de
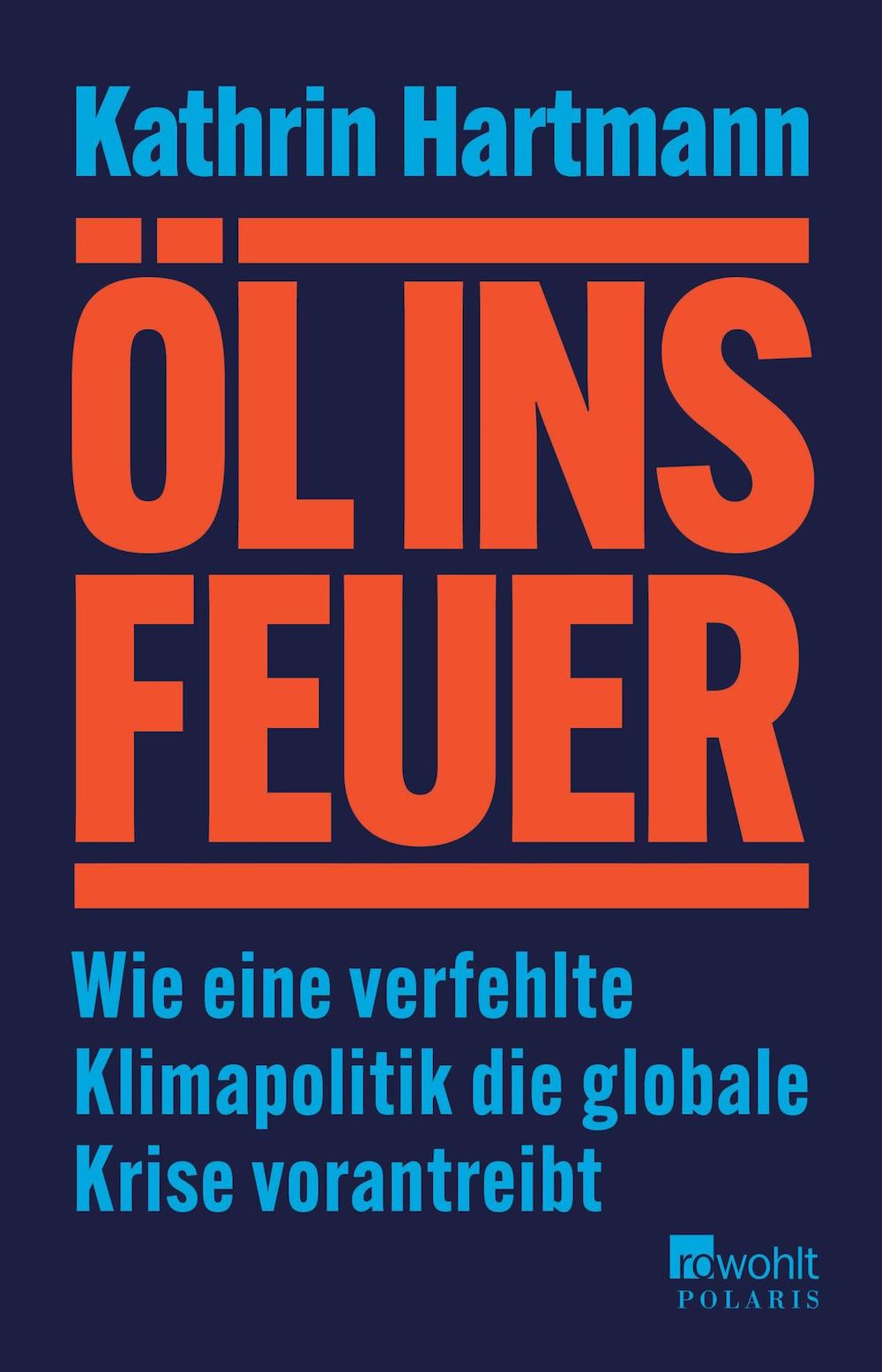
Kathrin Hartmann
Öl ins Feuer
Wie eine verfehlte Klimapolitik die globale Krise vorantreibt
272 Seiten
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 2024
Erstellungsdatum: 14.04.2025