


 MENU
MENU

Gott, so heißt es, habe den Menschen so verführbar und manipulierbar geschaffen, dass er nicht nur an den Teufel, sondern sogar an Gott glaubt. Beide betrachten in Andreas Maiers Roman „Der Teufel“, wie sich der Mensch medial von der Teilung der Welt in Gut und Böse überzeugen lässt. Das Fernsehen hat demnach unser Denken vereinfacht. Was Ewart Reder über das Buch mitteilt, regt die Neugier und die Leselust an.
„Der Teufel und der liebe Gott sehen zu, wie die Familie ins neue Haus zieht.“ So lautet der erste Satz von Andreas Maiers neuem Roman „Der Teufel“. Ähnlich wie in Goethes Faust treten, bevor etwas geschieht, der Teufel und der liebe Gott auf. Die Handlung bekommt ein religiöses Framing, Gut und Böse sind da, bevor jemand etwas tut, das moralisch beurteilt werden könnte. Was die Familie, vorneweg der kindliche Protagonist Andreas in dem neuen Haus tun werden, ist vor allem fernsehen, und da ist es genauso: „In den Nachrichten gab es die Guten und die Bösen.“ Bevor etwas berichtet wird, ist es schon bewertet.
In der Hauptsache ist der Roman eine Studie über die Wirkungsweise von Massenmedien. Die Beobachtungen hierzu sind genau. Beinahe noch genauer ist das Denken, das der Autor anstrengt, um aus den Beobachtungen auf das Phänomen zu schließen. So entsteht im Lauf der Erzählung die typisch Maiersche Pendelbewegung zwischen sublimer Komik und luzider Erkenntnis. Die Serienhelden „trugen ihre Waffen am rechten Fleck, verfolgten die Bösewichte und fingen oder erschossen sie auch regelmäßig, so daß Recht und Ordnung wiederhergestellt waren.“ Nicht anders, schon gar nicht differenzierter vermittelt das Fernsehen die reale Welt. Die Guten sind immer wir, die Bösen werden klar gekennzeichnet. Aus dem Hass auf sie speist sich die ‚gute‘ Identität. Die BRD ist gut, die DDR böse. Über eine Tante, die ihr Leben aus Überzeugung in der DDR verbracht hat, können nur Lügen erzählt werden: Sie werde gezwungen, so zu denken. Das Ausmaß, in dem Maiers Figuren vom Fernsehen vereinnahmt werden, lässt nur eine Bezeichnung zu: totalitär. Den Ort, in dem das Kind aufwächst – Schauplatz von „Ortsumgehung“, dem Zyklus, zu dem auch der neue Roman gehört – diesen Ort kennt Andreas „nur sehr punktuell von einigen Autofahrten“. Seine Welt stammt aus dem Fernsehen. Bis in die Träume hinein bestimmen anerkannte Verdikte, wer der Bösewicht ist, den man eigenhändig zu erwürgen hat. Eine spezielle ‚Übersetzung‘ der TV-Nachrichten liefert der geistig eingeschränkte Onkel J. Da er den Sinn nicht versteht, beobachtet er seinen Schwager, Andreas’ Vater, und entnimmt minimalen Veränderungen von dessen Mimik, wer die Guten sind, wer die Bösen. Da gibt es kein Vertun. Und sonst gibt es da nichts zu tun. Fernsehen ist rechthaben.
Andreas Maiers Generation sind die TV-Natives. Sie haben die Reichweite des Massenmediums erfahren und können die Nachgeborenen warnen, die andere Medien nutzen (beziehungsweise von ihnen genutzt werden). Ein Seitenblick lohnt zu Jochen Schmidt, Autor der gleichen Generation, der ebenfalls ein Buch über seine Fernsehbiographie vorgelegt hat: „Zu Hause an den Bildschirmen. Schmidt sieht fern“. Hier guckt ein Kind im Osten – aber dieselben Programme. „Ohne Westfernsehen wäre die DDR kaum erträglich gewesen und sicher früher zusammengebrochen“, mutmaßt Schmidt. Andererseits verpflanzte das Westfernsehen seine Wertungen in ein Land, das sich als böse erkennen musste und also nicht so bleiben konnte. Noch in der Ironie des Humoristen Schmidt hat das ‚freie‘ Westmedium den totalitären Subtext: „Im Westfernsehen sagten sie die Wahrheit, aber mein Leben kam trotzdem nicht vor, deshalb guckte ich ja! Mein Leben kannte ich selbst“. Anders als Maiers Figuren entwickelt der Dissident ein waches Gefühl für die Ambiguität von Meinungen. Wer so denkt, ist schon fast unerreichbar für Manipulation: „So ist es mit allem, es gibt immer eine Ansicht, die sich durchgesetzt hat, und eine gegenteilige Ansicht, die sich ebenfalls durchgesetzt hat. Wahrscheinlich sind beide falsch.“ Auch die erzieherische Intention des West-TVs den Ossis gegenüber scheitert, wenn die das Agenda-Setting nicht mitmachen. Schmidt über freie Meinungsäußerungen, die es in der DDR der Achtziger zuhauf gab: „Eigenständige politische Einschätzungen aus dem Volk beeindruckten mich immer, da ich eigentlich davon ausging, dass sich niemand für diese Dinge interessierte.“
Andreas Maiers heranwachsendem Ich fehlt diese Distanz, wie auch allen anderen Figuren des Romans. Umso klarer zeichnet „Der Teufel“ nach, was für Lügen die jüngste Geschichte begleitet haben, organisiert und tausendfach wiederholt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der Wende-Triumph – deklariert als aufrichtige Freude über die Befreiung der „Schwestern und Brüder“ – erweist sich als hohl: Onkel J. kann die Gefühle, von denen sein Schwager redet, in dessen Gesichtszügen nicht finden, sich darum nicht mitfreuen. Was bleibt, ist die NATO-Osterweiterung. „Noch ein Jahr zuvor hätte diese Ost-Bewegung der NATO den Versicherungen aller nach einen Weltkrieg ausgelöst.“ Papa Bushs Krieg gegen den Irak wird als moralische Lektion verkauft, wie Schurken sie verdienen. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg des Sohns erscheint als technisch brillante und verantwortungsbewusste Strafaktion gegen den Teufel persönlich, basierend auf der (zu ergänzen wäre: nachrichtendienstlich deutschen) Lüge über angebliche Chemiewaffen des Irak. Herz- und Meisterstück der Maierschen Medienkritik ist eine längere Passage zur Berichterstattung über Jugoslawien in den Neunzigern. Zur Rolle der FAZ damals hat Peter Handke Ähnliches zusammengetragen in seiner „Winterlichen Reise“, nicht ohne der nationalistischen Propaganda der serbischen Regierung in Teilen aufzusitzen. Hiervon bleibt Maier frei, belässt es beim akribisch nachgeschauten TV-Ton und -Bild aus Deutschland, nebst Auswertung. „Es bleibt, dass der Serbe nach dem Gesetz der Straße handelt und prügelt und zuschlägt, wo auf der anderen Seite nur Polizei und Regierung, also Ordnungshüter und Verfassungskräfte, agieren. Aggressionen und Angriffe gibt es nur von seiten der Serben, die Wortlaute sind so gewählt, dass von den Kroaten niemals Angriffe oder Aggressionen ausgehen.“
Was bewirkt nun all dies verlogene Einteilen der Welt in Gut und Böse, in Wir und die Anderen? Da läuft der Autor zur Hochform auf, erzählt Weihnachten als familiäre Übung in manipulativem „Zauber“ und die Carrerabahn als etwas, was kindliche Vollmitglieder der Gesellschaft besitzen müssen. Vor linker Subkultur, in die der Jugendliche sich flüchtet, macht Maiers analytischer Blick nicht halt. Ein brachialer ‚Feminismus‘ teilt die Welt in männliche Täter und weibliche Opfer ein. Humoristisches Highlight: ein Coitus, währenddessen der Junge sich für die am Ende unausweichliche Ejakulation ausdauernd vorverurteilt. Den Alten werfen die Jungen Uniformierung vor. „Wir dagegen trugen keine Uniformen, deshalb kleideten wir uns auch alle (sic!) hauptsächlich vom Flohmarkt.“ Solchen Spuren müsste gründlich nachgegangen / -geforscht werden: Behaupten sich das Patriarchat und ein gesellschaftlicher Uniformismus am Ende dadurch, dass sie ihre Alternativen korrumpieren? Außer grandios erzählt ist „Der Teufel“ ein Pamphlet über mediale Lügenwelten, an dem keine ernsthafte Debatte künftig vorbeikommt.
Nicht nur die ausführlichsten, auch die bestürzendsten Belege dafür, dass die Manipulation greift, findet Maier in der eigenen Familie. Der Vater und sein Bruder, gleichzeitig der Gundstücksnachbar, sind so verfeindet wie West und Ost. Zwischen den Grundstücken steht ein Zaun, der die Welten so trennt wie die innerdeutsche Mauer. Hinzukommt, dass Vater und Mutter insgeheim auch verfeindet sind, nur nach außen noch den Schein der Wohlanständigkeit wahren. Recht haben, die Guten sein, alle um sich herum dominieren – das Hirngespinst steuert alle, die es lernen, bis jeder Frieden und jede Ordnung kaputt sind.
Der eingangs erwähnte faustische Prolog des Romans hat es insofern schwer. Er besteht nur aus dem zitierten Satz, Gott und der Teufel sind nur Zuschauer. Für das Leben, wie für das Fernsehen, wäre das an sich genug: Instanzen, die alles bewerten. Wie die Vorzeichen eines Musikstücks dessen Tonart festlegen, bestimmen der himmlische und der höllische Zuschauer, dass und wie das Leben bewertet wird. Vereinzelt tauchen die Instanzen noch mal auf, der Teufel zum Beispiel als jemand, der an den Liebeswirren des Teenagers Andreas Spaß hat, „wenn auch nur im Sinne einer Fingerübung“. Mephistos Loblied auf den Sex lässt grüßen („hab ich doch meine Freude dran“). Aber das Buch übt ja Kritik an externen Bewertungen. Wo es sie auffindet, zeigt es, wie das Leben darunter leidet, sein Eigengewicht verliert. Auch der Teufel kann dieser Kritik zum Opfer fallen. Und tut es. In der Stadtkirche, einem wichtigen Schauplatz des Romans, erklärt eine Frau dem Jugendlichen das Altarbild dahingehend, dass es den Teufel darstelle, der von einer starken Hand bekämpft werde. Jahre lang ist es das, was Andreas auf dem Bild sieht. Bis es eines Tages verschwindet und nach Monaten in restauriertem Zustand wieder erscheint. Das Aussehen der Teufelsfigur hat sich bis zur Unkenntlichkeit verändert. Der Restaurator, den Andreas befragt, hat von einem Teufel auf dem Bild noch nie gehört. Um einen Heiligen handele es sich. Der Teufel ist der Wissenschaft, in dem Fall der Kunstgeschichte, zum Opfer gefallen. Er war nur die Marotte einer Frau, die einem jungen Mann die Welt erklären wollte.
Und Gott? Der befindet sich ja in der gleichen Gefahr. Andeutungsweise entgeht er ihr aber knapp. Zumindest ist sein Haus – die gotische Stadtkirche – der Ort, an dem Andreas die erhabensten Gefühle des Buches hat. Wie das beschrieben wird allein, lohnt die Lektüre. Seit seinem Debüt „Wäldchestag“ ist Andreas Maier ein Autor, der die „nüchterne Trunkenheit“ nach Augustinus beschreibt, den „Rausch des Seins“, wie Konstantin Wecker es nennt in seinem neuesten Buch, das unter anderem die Geschichte seines Alkoholentzugs erzählt. Am Ende von „Der Teufel“ geht Andreas noch mal in die Stadtkirche und ihm wird klar, wie der Raum auf ihn wirkt, nämlich wie sein Zimmer vom Anfang des Romans – vom Anfang seines Lebens –, in dem er lange Tage allein lag, von einer ungenannten Krankheit befallen, und die Stille erlebte. In diesem Zimmer wurde noch nicht ferngesehen. Die bewertete, aus zweiter Hand empfangene Welt gab es noch nicht. Möglicherweise entkommt Gott über diese Assoziationsbrücke seiner Abschaffung durch die Maiersche Medienkritik. Aber das wird erst der nächste und, wie man hört, letzte Band der „Ortsumgehung“ entscheiden. Er soll „Der liebe Gott“ heißen.
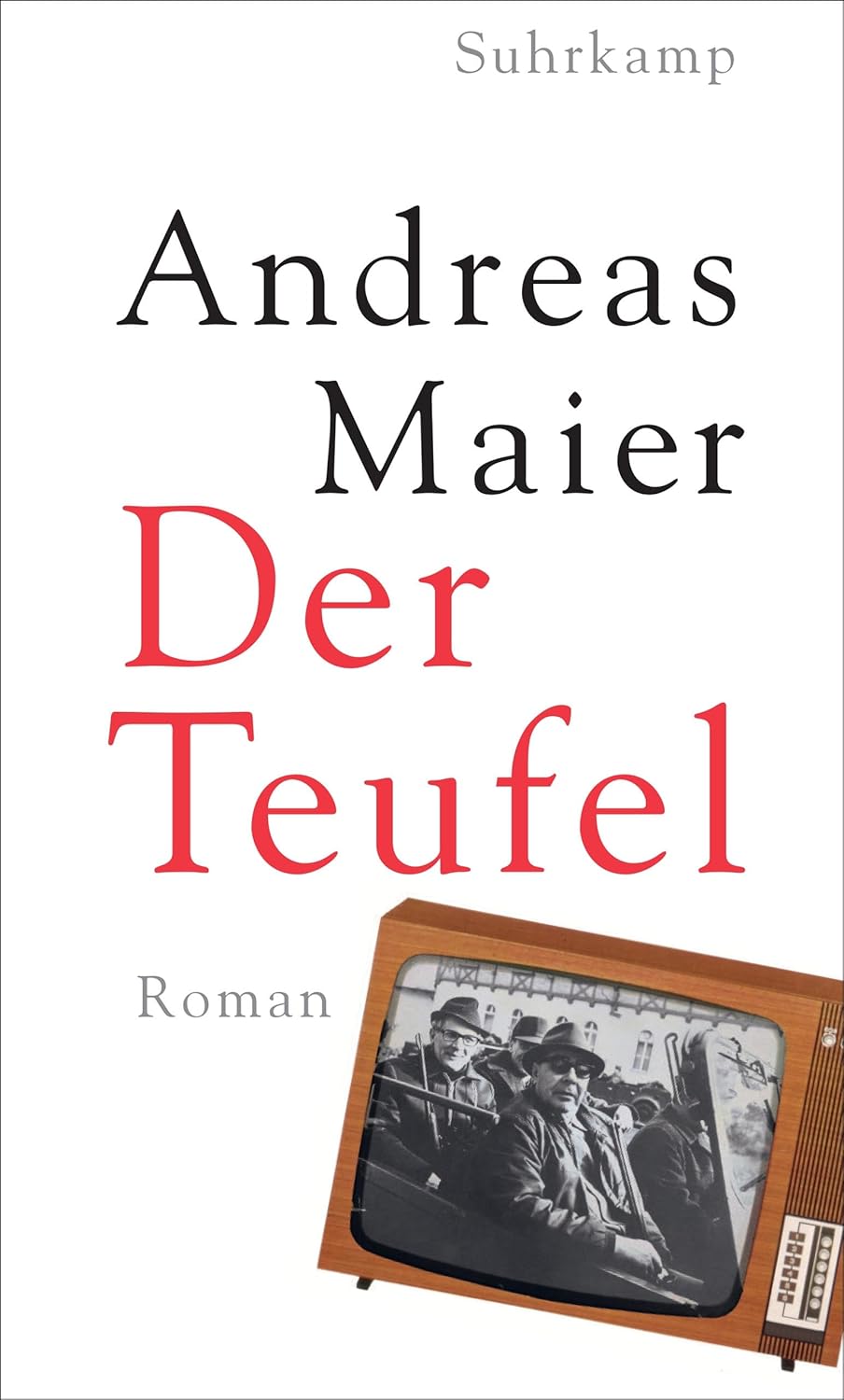
Andreas Maier
Der Teufel
Roman
247 S., geb.
ISBN: 978-3-518-43231-0
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025
Erstellungsdatum: 09.11.2025