


 MENU
MENU

Die Angst, irgendetwas zu vergessen, hat ihn umgetrieben; die Erinnerung bis ins kleinste Detail zu protokollieren und die erlebte Gegenwart ebenso fortlaufend zu notieren, wurde ihm zur Obsession. Und manchmal gewinnt man den Eindruck, als hätte Peter Kurzeck sein Leben vor allem gelebt, um es aufzuschreiben. In den jetzt erschienenen Band seines Zyklus‘ „Das alte Jahrhundert“, „Frankfurt – Paris – Frankfurt“, hat sich Ulrich Breth hineingelesen.
Die Dimensionen, die das Werk Peter Kurzecks inzwischen angenommen hat, sind nicht denkbar ohne das stete Bemühen seines Lektors Rudi Deuble, den Blick auf dessen besondere Architektonik freizulegen. Dies gilt insbesondere für das Großprojekt „Das alte Jahrhundert“, das durch die Veröffentlichung des Bandes „Frankfurt-Paris-Frankfurt (Das alte Jahrhundert 10)“ zum mutmaßlichen Abschluss gekommen ist. Angelegt war die Chronik auf insgesamt 12 Bände, von denen fünf zu Lebzeiten des Autors und nun vier weitere posthum erschienen sind.
In der Chronik, an der Kurzeck vom Beginn der 1990er Jahre bis zu seinem Tod im November 2013 gearbeitet hat, geht es um zwölf Monate des Jahres 1983/84 aus dem Leben des Autors, an denen er beispielhaft auf das eigene Leben oder die Zeit an sich zu sprechen kommt. So zumindest hat er es in einem Interview mit Ralph Schock formuliert, das 2011 in der Zeitschrift „Sinn und Form“ erschienen ist. Es gehört zur besonderen Eigenart Kurzecks, daß er das so sagen kann: das eigene Leben oder die Zeit an sich. Denn in seinem Leben geht es immer um alles, seitdem er im Alter von fünf Jahren beim Lesenlernen bemerkt hat, dass er dafür zuständig ist, die Einzelheiten der Welt aufzubewahren. Dieses Wächteramt hat er zeitlebens ausgeübt, gleich einem Engel, als den ihn Andreas Maier in seinem Nachwort anlässlich der Neuausgabe von Kurzecks Romandebüt „Der Nußbaum gegenüber vom Laden, in dem du dein Brot kaufst“ bezeichnet hat. Keiner hat Kurzeck so beschrieben wie Andreas Maier in diesem Text. Das minimale ständige Zittern, das durch diese kleine Person ging, seine Nähe zu einem Zustand, den Freud als kindlichen Narzißmus beschrieben hat, der ihn dazu trieb, daß er sich alles immer selbst erzählen mußte, indem er es einem Du erzählte, das er selbst war. Denn ein jeder Engel kennt nur sich. Maier versetzt Kurzeck auch insofern in die Sphäre der Engel, als um ihn herum keine Zeit war. Er war außerhalb der Zeit. Er lebte in einer Art Ewigkeit, einem stehenden Jetzt, einer fortwährenden Erinnerungsgegenwart, und seine Literatur erzeugte das mindestens ab „Das alte Jahrhundert“ in jedem Satz. In jedem Augenblick sind alle anderen gegenwärtig. Bekanntlich hat Walter Benjamin in einem seiner berühmtesten Texte, in dessen Zentrum ebenfalls ein Engel steht, diesen Zustand mit dem der erlösten Menschheit in Verbindung gebracht, der ihre Vergangenheit in jedem ihrer Momente zitierbar geworden ist. Das ist der Stern, unter dem Kurzecks Chronik des alten Jahrhunderts angetreten ist. In ihr entsteht ein sehr präzises Bild des Frankfurter Stadtteils Bockenheim in den frühen 1980er Jahren, das zugleich symptomatisch für den Weltzustand ist. Dabei geht es in seiner Prosa nicht um Lokalkolorit. Wer einen Ort in allen Einzelheiten derart erfahren und in sich aufbewahrt hat wie Kurzeck die Häuser und ihre Bewohner in der Jordanstraße und der Robert-Mayer-Straße, weiß auch, wo alle anderen Orte der Welt zu finden sind. Von seinen Texten geht die Suggestion aus, dass man nicht alle diese Orte aufsuchen kann, es aber zumindest versuchen soll. In seinem Parisbuch, wie er den Band, der jetzt erschienen ist, gelegentlich genannt hat, heißt es dazu: Immer schon hast du alle Menschen kennen wollen, alle die mit dir auf der Welt sind. Und daß wir das Leben teilen. Und wenige Seiten später: Kein Augenblick soll verloren sein.
Dem ist er in „Übers Eis“ nachgegangen als einer, der die Last der Welt trägt und zugleich beim Gehen die Schuhe schonen muss. Als das Jahr 1984 anfing, nach der Trennung hatte ich von einem zum andern Tag nix mehr. Auch keine Wohnung, kein Selbstbild, noch nicht einmal Schlaf ist mir übrig geblieben. Die Mittellosigkeit nötigte ihn, ständig sein Geld zu zählen, wie ein Engel über Frankfurts Straßen zu schreiten und jede Arbeit in Betracht zu ziehen, um seine prekäre Lage zu verbessern.
Auch die eines Logenschließers am Theater, zu dem ihm ein bereits in der Verlagswelt angekommener Bekannter geraten hat, der ihm zwei Jahre zuvor ein Zelt geliehen und ihn zweimal mit seinem orangefarbenen Golf mitgenommen hat. Dann folgt die denkwürdige Formulierung, mit der er seine unverbrüchliche Dankbarkeit gegenüber dem kürzlich verstorbenen Harry Oberländer in ironischer Form ins Bild setzt. Von da an jeden Golf jedesmal gleich gegrüßt, auch wenn er die falsche Farbe. Aber auch jedes orangerote Auto, auch wenn es kein Golf.
Das Bewerbungsgespräch führt nicht zur Einstellung, bietet Kurzeck aber Gelegenheit, mit wenigen Worten in der Figur des Hausinspektors, der das Gespräch mit ihm führt, eine Gestalt des alten Jahrhunderts erstehen zu lassen, an der die mentale Lage der Bundesrepublik ablesbar wird. Bevor er sich dem Bewerber zuwendet, muß er noch dringend am Telefon mehrere Dienstangelegenheiten klären: Disseplin und mit eisernem Besen! Höchstpersönlich! Bis zur Vergasung! Schließlich erkundigt er sich nach dem Familienstand des Bewerbers: Kinder? Ein Kind? Ja, gemacht sind sie schnell! Brauchen Ordnung und Disseplin. Um dann in zwei Bemerkungen auf die eigene Biografie zu sprechen zu kommen. In Praunheim ein Haus gebaut. Neubauviertel, zwei Kinder. Waren Sie schon in Praunheim? Erst den Sohn und dann eine Tochter ist praktischer! Die Kinder längst groß. Disseplin. Und wenige Zeilen später heißt es: Aus Posen. Seinerzeit ehemals Flüchtling. Jetzt Hausbesitzer in Praunheim. Kennen Sie Praunheim? Neubau im Neubaugebiet. Ein deutsches Haus. Disseplin. Preußen, preußische Tugenden. Unteroffizier. Der Ausdruck Disseplin reicht aus, um ein Leben zu charakterisieren, in dem sich die Erfahrungen der Nazizeit in die Nachkriegszeit verlängert haben; an den Verschleifungen in der Aussprache wird greifbar, wie unbrauchbar, wie fatal diese Erfahrungen inzwischen geworden sind. Damit gehört er in eine Reihe mit dem Hausmeister und dem Nachbarn in der Jordanstraße, deren Leben sich in zwanghaften Ordnungsritualen wie der wöchentlichen Reinigung des Treppenhauses mit einer Kolonne dampfender Putzeimer oder der Säuberung des Gehsteigs der gesamten Straßenfront einschließlich der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem zum Großhandelspreis erworbenen Spezialbesen auslebt sowie dem Griff nach der Bierflasche, dem Flachmann, den Zigaretten, dem Lottozettel und der Bildzeitung. Und Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg.
Solche und andere Gestalten sind die Exponenten der Kurzeck-Welt, in der die Häuser zittern, in der die Inder und Hilfsinder, die für einen Stundenlohn von dreineunzig in einer Spülküchenhölle ihre Arbeit verrichten, in der U-Bahn im Stehen und im Sitzen und selbst im Schlaf und im Halbschlaf zittern, in der selbst das Licht zittert und schließlich alles zittert, in der sich die Straßen in Bewegung setzen und zu fahren anfangen, bis die Stadt fährt und schließlich auch die Welt anfängt zu fahren. In diesem Zustand scheint sie für einen Augenblick ausbalanciert. Der Engel der Erinnerungsgegenwart, der dies zustande bringt, ist keine metaphysische, sondern eine poetische Figur. Sein Mantra, dem der Hinweis an ein Gedicht von Ingeborg Bachmann und damit mittelbar auch an Kurzecks böhmische Heimat eingeschrieben ist, lautet: An das Meer muß man glauben.
Der Band „Frankfurt-Paris-Frankfurt“, der jetzt erschienen ist, entstand aus einer Rückblende, die in ein längeres Manuskript eingeschaltet werden sollte, aus dem später „Übers Eis“ hervorgegangen ist. Einzelheiten der Entstehungsgeschichte hat Rudi Deuble in seinem Nachwort des Herausgebers mitgeteilt, in dem aus Kurzecks Projektbeschreibung des Bandes für einen Antrag auf ein Stipendium Anfang 1997 zitiert wird: Der dritte Band enthält eine lange Rückblende in das Jahr 1977. Der Erzähler und seine Lebensgefährtin, später die Mutter seiner Tochter, kommen in die Stadt. (…) Mitte Oktober fahren sie nach Paris, um dort einen Freund zu treffen. 1977 war das Jahr der Schleyer-Entführung, die eine massive Terrorismusfahndung zur Folge hatte.
Als der Autor mit seiner Gefährtin Sibylle am 31. August 1977 von Staufenberg nach Frankfurt aufbrach, neigte sich der Sommer, in dem in Graceland der King of Rock 'n' Roll gestorben war, seinem Ende entgegen. Fünf Tage später sollte mit der Entführung des ehemaligen SS-Untersturmführers und späteren Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch die Rote Armee Fraktion (RAF) der sogenannte deutsche Herbst beginnen. Der Autor hatte mit Sibylle eine Wohnung in der Basaltstraße bezogen und dort am 1. September auf der geliehenen elektrischen Schreibmaschine ein weißes Blatt Papier eingespannt, auf dem das Mittagslicht zitterte, um mit der Reinschrift der letzten Fassung seines ersten Romans zu beginnen. Draußen, möglicherweise in der Basaltstraße oder auf dem nahegelegenen Hessenplatz, stand sein alter Opel, der schon fast am Zusammenbrechen war. Das schien nicht weiter wichtig, denn er vergaß in Frankfurt vom einen zum andern Mal nicht nur, wo das Auto stand, sondern sogar daß wir ein Auto hatten. Mit diesem Auto sollte er in den kommenden Wochen zweimal die deutsch-französische Grenze überqueren. Das erste Mal, um seinen Freund Jürgen Klaus außer Landes nach Metz zu bringen, weil ihn der Staat von früh auf beharrlich verfolgt hat, und ich bin für ihn eh und je die Gerechtigkeit und das Leben und bin dafür zuständig und der einzige furchtlose Mensch, den er kennt. Die politischen Zustände, die in der Bundesrepublik vierzehn Tage nach der Schleyer-Entführung herrschen, hat er bereits vorher in einem bündigen Satz, der ohne Verb auskommt, zusammengefasst: Die Zeit und die Zeitungen, das blöde Volk und der niederträchtige Staat. Der Freund, der von zwei Männern mit Hüten und Aktentaschen observiert wird, sich ständig verfolgt fühlt, möchte das Land verlassen. Auf dem Weg nach Sachsenhausen geraten der Autor und sein Freund in eine Polizeikontrolle. Vor der finsteren alten Gutleutkaserne stellten sie uns. Sie waren bewaffnet. Wir wurden an die Wand gestellt. Arme hoch, da an die Mauer! Dreifach abgetastet, kontrolliert, beleidigt, herumgestoßen, kontrolliert und nicht auf der Flucht erschossen. Durch seine Vorgeschichte und die bedrohliche Atmosphäre, die der Text nachzeichnet, nehmen die Fluchtpläne des Freundes Gestalt an. Aus einem am liebsten wird ein unbedingt. Dabei verschiebt sich der Fluchtort von Spanien oder Portugal über Russland, Norwegen, Irland und Island, bis er den Schlüssel zu einem Haus in Algeciras unweit von Gibraltar in den Händen hält. Um dorthin zu gelangen, brechen die Freunde, gemeinsam mit Jürgens Freundin Doris und seinem Sohn Besino, zur französischen Grenze auf. Auch dort werden sie von deutschen Beamten umstellt und kurzfristig festgehalten. Aber auch diesmal dürfen sie lebendig weiterfahren. Einen Tag später besteigt Jürgen spätabends am Bahnhof in Metz den Zug nach Paris.

Als Kurzeck Mitte Oktober, gemeinsam mit Sibylle und Doris, das zweite Mal die deutsch-französische Grenze überquert, führt sie ihre Reise in die Stadt an der Seine. Sie werden sich dort mit Jürgen treffen, der seine Abreise nach Algeciras vorbereitet, um sich einer möglichen Festnahme zu entziehen. Mit ihm verbindet ihn eine auratische Freundschaft. Er braucht nur am Telefon seine Stimme zu hören, um ihn vor sich zu sehen und mit ihm zu einer Person zu verschmelzen. Mein Freund Jürgen, da kommt er die Straße herauf, als sei ich es selbst, der da geht. Und er möchte die Stadt der Liebe und die Metropole der ästhetischen Moderne wiedersehen, die er bereits mehrmals besucht hat und die nach wie vor ihre magische Wirkung auf ihn ausübt. Als ob du die Gegenwart, Stadt und Zeit, als ob du dich in deine Gedanken hinein immerfort selbst träumst. Passanten. Oder ist es die Stadt, die uns träumt? So gehst du und weißt nicht, als wer du hier gehst und wie du je wieder heimfinden sollst.
Kurzeck pflegt nicht nur einen repetitiven Stil, in dem die Welt in jedem Augenblick neu entsteht. Es geht immer wieder auf Mittag und der Himmel fängt an zu leuchten. Auch während seines Parisaufenthalts im Oktober 1977 kehren alle früheren Besuche der französischen Metropole dorthin zurück. Vor allem die drei Wochen, die er dort als Achtzehnjähriger im Sommer 1961 verbracht hat. Aber auch der Parisaufenthalt seines Vaters als sprachloser böhmischer Aushilfskellner in den 1920er Jahren, den er für sich und Sibylle am Boulevard des Capucines imaginiert. Es ist immer Paris.
Wenn er die Auslagen der Delikatessenläden rund um den Markt beschreibt, den er aufsucht, um eine Auswahl von Speisen für ein opulentes Frühstück zu besorgen, dann gerät das zu einem Fest der Sinne, das den kommenden Genuß vorwegnimmt. Pasteten, Langusten, Austern, Muscheln, Schnecken, Seeigel, gekochtes Rindfleisch, gebratene Wachteln, gebratene Tauben, Taubensuppe, Fasanenbrühe, Entenbrust, Gänsebrust, Gänse-Rillette, Rebhühner, Sogar noch die einfachsten Beilagen, Hirse, Reis, Linsen, Bohnen, Kraut, und Katoffelbrei geraten ihnen zu Delikatessen. Eingelegte Pilze, Auberginen, Artischocken, Anchovis, Silberzwiebeln, Tomaten, Salat, Oliven und Lauch, nie vorher so guten Lauch probiert. Roastbeef, Rehrücken, Lammfilet, Ochsenschwanz, Ochsenzunge, Weinkutteln, Milchkutteln, Trüffel, Wildschweinragout, schon das Aussuchen wird ein Fest. Solche verschwenderischen Aufzählungen folgen dem Optativ Von allen Speisen wollen wir kosten!, der sich sowohl im Text als auch in den Notizen zum Parisbuch findet. Dieser Gestus der Weltaneignung bezieht sich nicht nur auf Speisen, sondern auf alles, was ihm unter die Augen kommt, darunter auch Küchenzeug, Rohrstöcke, Familienalben, Kaffemühlen, Knöpfe, Federbüsche, Holzelefanten, Maulkörbe, Mausefallen und lebendige Vögel.
Paris ist für Kurzeck der ideale Ort, um als Schriftseller seinen Platz im Leben einzunehmen. Bereits auf der Fahrt nach Metz hat er sich den französischen Behörden gegenüber als ecrivain, und damit erstmals überhaupt, als Schriftseller vorgestellt. Man könnte auch sagen, daß ihn die Franzosen den Schriftsteller sein lassen, als den er sich schon immer gesehen hat. Schriftsteller zu sein, ist für ihn eine Form des Überwältigtseins. Paris und sich selbst kann er nicht widerstehen. Selbst ein besserer Autofahrer ist aus ihm geworden. Während ihn die deutsche Straßenverkehrsordnung wiederholt vor Probleme stellt, kann ihm selbst ein Frontalzusammenstoß auf dem Weg nach Paris nichts anhaben, kommt er mit dem Straßenverkehr in der Metropole bestens zurecht.
Kurzecks poetische Anverwandlung der Welt ist nicht denkbar ohne Espresso, Zigaretten und Unmengen von Alkohol, von dem er sich nach einundzwanzig Jahren erst zwei Jahre später lossagen wird, und die Nähe seiner Gefährtin, mit der er zwanglose Stunden und halbe Tage im Hotelzimmer, in den Bars und den Straßen von Paris verbringt und deren erotischer Reiz den ihrer zahllosen unbekannten Schwestern miteinschließt, etwa wenn er auf der Rückfahrt von Paris nach Frankfurt einer unbekannten Schönen hinterher sieht. Und dann hat sie nochmal den Kopf gedreht, damit sie als Bild für immer bei mir, damit ich ihr Bild behalte. Als ob sie in meinem Leben noch vorkommen soll. Ein Versprechen, das fast mehr ist, als man vom Leben im deutschen Herbst verlangen kann. Nach der Rückkehr nach Frankfurt steht der Umzug von der Wohnung in der Basaltstraße in die nahegelegene Kaufunger Straße an. Dabei fällt ihm auf, dass er während des Schreibens meist zwei Songs gehört hat. Seit Paris zwei Lieder hauptsächlich. Janis Joplin: Me and Bobby McGee und die Rolling Stones mit No Expectations. Zwei Songs also, in denen sich frühzeitig im alten Jahrhundert die radikale Verkürzung des utopischen Erwartungshorizonts mitgeteilt hat.
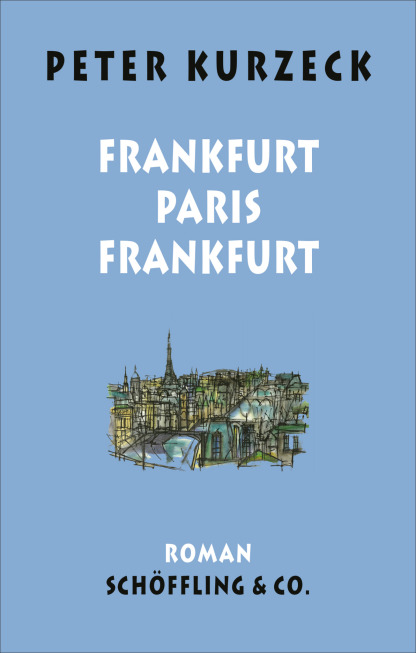
Peter Kurzeck
Frankfurt – Paris – Frankfurt
Roman
Herausgegeben von Rudi Deuble
Nachwort von Rudi Deuble
288 S., geb.
ISBN 978 3 89561 694 5
Schöffling Verlag, Frankfurt am Main 2024
Erstellungsdatum: 09.10.2024