


 MENU
MENU
„Souvenirs d’un apatride” von Daniel Cohn-Bendit und Marion Van Renterghem

Daniel Cohn-Bendit, jetzt 80-jährig, wurde im Paris der späten 1960er-Jahre von den Medien zum Sprecher („Dany le Rouge“) der Bewegung 22. März gemacht. In Frankfurt wurde er mit Joschka Fischer Wortführer der undogmatischen Linken („Spontis“). Beide Städte belebte er mit zahlreichen Aktionen, bevor er als erster Frankfurter Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten und als Europa-Parlamentarier wirkte. In dem Buch „Souvenirs d’un apatride”, das jetzt in Frankreich veröffentlicht wurde, gibt er Auskunft über sich selbst. Und Rainer Erd hat es gelesen.
Autobiografien von Politikern begegnet der Rezensent zumeist mit Distanz. Zu häufig liest man, von einem anderen geschrieben, Erzählungen des eigenen Lebens, deren Unglaubwürdigkeit sich rasch erschließt. Das kann in der Weise geschehen, dass allgemein bekannte Probleme der betreffenden Person einfach unerwähnt bleiben oder sie elegant mit erfundenen Episoden beschönigt werden. Je prominenter ein Politiker, desto zurückhaltender häufig Lektoren, das Eigenlob des sich Porträtierenden zu hinterfragen.
Zu dieser Kategorie beschönigender Lebensbeschreibung gehört das angezeigte Buch nicht. Was es mit den erwähnten Autobiografien gemeinsam hat, ist der schreibende Dritte, hier die französische Journalistin Marion Van Renterghem. Aber bereits dann beginnen die Unterschiede des Buchs zu den erwähnten. Die Journalistin verfasst nach Berichten von Cohn-Bendit einen gut geschriebenen Text, aber der Porträtierte erzählt gleichermaßen ausführlich in eigenen Worten. So erfährt der Leser von beiden Personen aus einem Leben, das – von dramatischen Krisen geprägt – in zwei Ländern spielt und zwar häufig ungewollt in dem einen oder anderen.
Auf diese Weise entsteht ein Bild des weder Deutschen noch Franzosen, weder Juden noch Nicht-Juden Daniel Cohn-Bendit, das weit von dem entfernt ist, was man als interessierter Zeitgenosse kennt. Hier präsentiert sich kein rotlockiger Sunnyboy mit frechem Grinsen und provokativen Sätzen, kein ungezügelt hochtönig sprudelnder Agitator für sein multi-kulturelles Gesellschaftskonzept. Das Buch gibt einen intimen Einblick in das immer wieder durcheinandergewirbelte Leben eines „Staatenlosen“ („apatride“), der sich ein Ankommen in einem Leben wünscht, immer wieder aber daran durch äußere Umstände, aber auch durch eigenes Zutun gehindert wird. Dieses selbstkritische Reflektieren des eigenen, mittlerweile 80-jährigen Lebens des am 4. April 1945 in Südfrankreich (Montauban) geborenen Daniel Cohn-Bendit macht das Buch zu einer großen Lesereise in die vielfältigen Problemfelder des Autors.
Sie beginnen damit, dass die Eltern von Cohn-Bendit, beides Juristen, wegen ihres Judentums und ihres linken politischen Engagements 1933 von den Nazis gezwungen werden, das Land zu verlassen. Sie fliehen von Berlin nach Paris, in die Stadt, in der bereits einige deutsche Intellektuelle (wie Walter Benjamin und Hannah Arendt) Zuflucht gefunden haben. In diesen Kreisen werden sie im 15. Arrondissement von Paris in den nächsten Jahren leben, bis sie von den in Paris einmarschierten Nazitruppen gezwungen werden, in den Süden des Landes, nach Montauban, zu fliehen. Hier wird Dany, wie er in Frankreich vertraut genannt wird, nach der Niederlage der Deutschen geboren. Doch hier wollen die Eltern mit dem Neugeborenen (und seinem neun Jahre zuvor auf die Welt gekommenen Bruder Gabriel) deshalb nicht lange bleiben, weil sie nur schwer eine angemessene Arbeit finden. Sie kehren bald nach Deutschlands Kapitulation nach Paris zurück.
In Paris wachsen Daniel und sein Bruder Gabriel auf, bis der Vater 1950 die Familie verlässt und sich als Anwalt in Frankfurt/Main niederlässt. Er kann in Frankreich nicht als Rechtsanwalt arbeiten. Daniel ist fünf Jahre alt. Die Zeit in der Emigration hat den Vater psychisch so beeinträchtigt, dass er zu mehr Nikotin und Alkohol greift, als sein Körper verträgt. 1956 wird bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Obwohl die Eltern getrennt sind, reist die Mutter mit dem 13-jährigen Daniel nach Frankfurt/M. und pflegt den im Sterben liegenden Vater. Daniel muss gegen seinen Willen Paris verlassen und wird auf seinen Wunsch nicht in Frankfurt/M., sondern in der Odenwaldschule (damals noch skandalfrei) erzogen. Er vermisst Paris und die ihm geläufige französische Sprache.
Der Vater stirbt 1959 in Frankfurt/Main und die Mutter, mittlerweile wieder (ohne Daniel, der an der Odenwaldschule bleibt) nach Paris übersiedelt, vier Jahre später in London. Mit 18 Jahren ist Daniel Vollwaise, lebt in der Odenwaldschule und macht erste Erfahrungen mit der Schüler-Selbstverwaltung. Er wird der jüngste „président du parlament des élèves.“ Doch Paris ist ihm so wichtig, dass er nach dem Abitur an der Odenwaldschule 1965 wieder in den 15. Arrondissement zurückkehrt, wo er viele Jahre mit seinen Eltern und dem Bruder verbracht hat. Später wird er seine Heimatstadt Paris wieder Richtung Frankfurt/M. verlassen müssen, weil ihn die französische Regierung ausweist. Die Jahre des erzwungenen Wechsels zwischen Paris und Frankfurt/M. sind prägend für Cohn-Bendits Leben Mitte der 60er Jahre. Ein Psychologe schreibt damals über ihn: „M. Daniel Cohn-Bendit a souffert pendant son enfance de l’instabilité et des tension de son milieu familial, qui ont déterminé des disharmonies du développement ...“ (69) („Eine instabile Kindheit und familiäre Spannungen haben für Daniel Cohn-Bendit zu einer nicht harmonischen Entwicklung geführt“). Diese Argumentation wird ein Rechtsanwalt später verwenden, um die Ausweisung Cohn-Bendits aus Frankreich wegen eines vorschnellen „Heil-Hitler-Rufs“ gegenüber dem französischen Minister für Jugend und Sport, François Missoffe, zu verhindern.
Doch zunächst bleibt er in Paris und avanciert im Mai 1968 zum „Star“ der französischen Studentenbewegung. Wer sich an diese Zeit erinnert, hat einen kessen, meist lächelnden Cohn-Bendit vor Augen, der spielerisch durch die Medien tingelt und sich als Star der französischen Studentenbewegung feiern lässt. Ganz anders seine Selbstbeschreibung. Während ihn die französischen Studenten als ihren Anführer sehen, merkt er, dass er deren Positionen nur zum Teil vertritt. „Je me retrouvais leader d’un movement dont la majorité des gens ne me ressemblaient pas” (65) („Ich war Anführer einer Bewegung, dessen Mehrheit nicht so war wie ich“.) Die Rolle des Anführers ist ihm ungeheuer.
Vielleicht war das der Grund, warum er am 21. Mai 1968 mit dem französischen Innenminister, Christian Fouchet, in eine Konfliktsituation gerät, die dazu führt, dass er des Landes verwiesen wird. Ohne französische Staatsbürgerschaft gelingt es der Verwaltung mühelos, ihn nach Deutschland abzuschieben. Er kommt wieder nach Frankfurt/M. Aber obwohl er ein internationaler Star ist, wird er dort nicht mit offenen Armen empfangen, sondern die Frankfurter Studentenszene begegnet ihm mit Distanz. Ganz anders als er, der aktionistische Nicht-Theoretiker aus Paris, ist die Frankfurter Studentenbewegung von Groß-Intellektuellen wie Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas geprägt. In Frankfurt wird eine andere Sprache als auf dem Campus in Paris gesprochen. Frankfurt ist für ihn „mon exil“, er fühlt sich „tout un Parisien“ (73).
Freunde raten ihm, wieder nach Paris zurückzugehen, was er mit schwarz gefärbten Haaren und einer großen Sonnenbrille getarnt auch tut. Zu Fuß überquert er die Grenze. Die französische Presse feiert seine Rückkehr, aber er hat Angst, was nun passiert. Freiwillig verlässt er erneut Paris und wird von der französischen Schauspielerin Marie-France Pisier, die gerade den Film „Geraubte Küsse“ mit Francois Truffaut beendet hat, über die Grenze gebracht. Eine zauberhafte Romanze („Le révolutionnaire et l’actrice“) beginnt zwischen den beiden und hilft ihm, die psychisch anstrengende Situation zu meistern (77).
Trotzdem fühlt er sich nicht wohl in Deutschland. Bei einer Demonstration gegen den sengalesischen Präsidenten Senghor legt er sich – wie zuweilen in Frankreich – mit der Polizei an und landet in Untersuchungshaft. Aus Frankreich ausgewiesen, in Deutschland inhaftiert, resümiert er deprimiert (85). Zwar erhält er vom deutschen Staat eine Waisenrente von 700 DM, aber das reicht nicht zum Leben, er arbeitet als Kindergärtner (Uni-Kita), Buchhändler (Karl Marx Buchhandlung) und als Mitgründer einer alternativen Zeitung („Pflasterstand“) in Frankfurt/M. Er will dem Image des Revolutionärs entfliehen und ein Privatleben begründen.
Das gelingt ihm, aber seine Impulsivität verführt ihn – den freundlichen, häufig vermittelt auftretenden – immer wieder zu Provokationen, die er heute bedauert und sich schwer verzeihen kann (109). Ein großer Wunsch jedoch geht in Erfüllung: Er wird Teil einer von 1988 bis heute bestehenden Patchwork-Familie, die dem, der aus einem „komplizierten Elternhaus“ kommt, die ersehnte Stabilität gibt, um alltägliche Disruptionen verarbeiten zu können. Dany hat ein stabiles Zuhause gefunden, dem auch eine unerwartet in sein Leben tretende Tochter im Alter von 25 Jahren nichts anhaben kann. Er wendet sich von seiner revolutionären Vergangenheit ab und engagiert sich in der Ökobewegung. Später führt das zu einem Engagement bei den GRÜNEN. In Frankfurt/M. wird er Dezernent für multi-kulturelle Angelegenheiten – für eine Person, die in zwei Kulturen groß geworden ist, der ideale politische Job.
Er trifft auf den späteren Außenminister der GRÜNEN, Joschka Fischer. Im Gegensatz zum machtbewussten Fischer beschränken sich Cohn-Bendits politische Ambitionen zunächst auf lokale Engagements, als wolle er das endlich erreichte Familienleben nicht gefährden. Bei dieser Entscheidung bleibt er auch, als der französische Präsident Emmanuel Macron ihm 2017 das Umweltministerium anbietet. Er schlägt die Chance aus, wieder ein „Parisien“ zu werden. Cohn-Bendit hat in Frankfurt/M. seine Heimat gefunden, wenngleich er weiter regelmäßig nach Paris fährt.
Dabei war Cohn-Bendit dem jungen hoffnungsvollen Macron in einer Art „coup de foudre“ verfallen, traf sich mit ihm und einem Freund in Pariser Cafés und entwickelte Hoffnungen auf ein gestärktes Europa. Mit Macron schien er endlich in Sachen Europapolitik einen Gleichgesinnten gefunden zu haben, wie er ihm bislang nicht begegnet war. Doch die emotionale Beziehung zwischen den beiden findet ein jähes Ende, als Macron einen Vorschlag Cohn-Bendits für ein neues französisches Rentensystem nicht nur ignoriert, sondern zugleich ihre Beziehung abrupt abbricht. Der gekränkte Cohn-Bendit vergleicht Macron mit Don Juan, der seine Frauen nach einer kurzen Liebe gnadenlos fallen ließ. Selbstkritisch stellt er fest: „je m’enflamme rapidement“ (209). Zu keinem anderen Politiker wird er wieder ein so vertrauensvolles Verhältnis wie zu Macron entwickeln.
In den zwei Jahrzehnten als Abgeordneter der deutschen und dann der französischen GRÜNEN (1994 bis 2014) liefert er sich so manche Redeschlacht mit europäischen Politikern. Cohn-Bendit kennt keine Zurückhaltung, wenn er auf Personen wie Nikolas Sarkozy („Sarko“) oder Victor Orban trifft, deren politisch konservatives Konzept er nicht teilt. Das Europäische Parlament ist seine Welt. Anders als sein Mitstreiter aus frühen Jahren, Joschka Fischer, zieht es ihn nicht in die Höhen politischer Ämter. Macht übt keinen Reiz auf den am französischen „savoir vivre“ orientierten, mittlerweile die deutsche und französische Staatsbürgerschaft innehabenden Cohn-Bendit aus. Streitgespräche dafür umso mehr. Sie vertragen sich besser mit seinem französischen Lebensstil, der die Feinheiten der französischen Küche (Wein, Käse und natürlich Austern) ebenso schätzt wie den leidenschaftlichen Disput.
Mit dem Ende als Abgeordneter im Europäischen Parlament wird es um Daniel Cohn-Bendit in politischen Diskussionen stiller. Natürlich hat er weiterhin eine Meinung zu den großen Streitfragen der Gegenwart. Aus dem einstigen Revolutionär von 1968 ist längst ein freiheitsorientierter, am parlamentarischen System orientierter Politiker geworden. Aber politische Ämter nimmt er nicht mehr wahr, nicht zuletzt deshalb, weil eine neue Generation grüner Politiker herangewachsen ist (Robert Habeck, Annalena Baerbock), die das politische Geschäft eloquent beherrscht. Cohn-Bendit beschäftigt sich in einem Film mit seinem ungeklärten Jüdisch-Sein, schreibt Bücher (mit Claus Leggewie und Marion Van Renterghem) und ist in seinen beiden Heimatstädten Frankfurt /M. und Paris ein gern gesehener Diskussionspartner.
Vergleicht man die beiden erwähnten unlängst erschienenen Bücher von Cohn-Bendit, dann ist der französische Band deshalb sehr empfehlenswert, weil er einen intensiven Einblick in das mediale und persönliche Leben eines deutsch/französischen Politikers gibt, wie ihn Europa in den vergangenen knapp 50 Jahren selten erlebt hat – ohne jede narzisstische Geste, sondern mit dem Blick eines Mannes, der sich darüber verständigen will, warum er geworden ist wie er ist. Eine vorbildliche Haltung für einen Autobiografen.
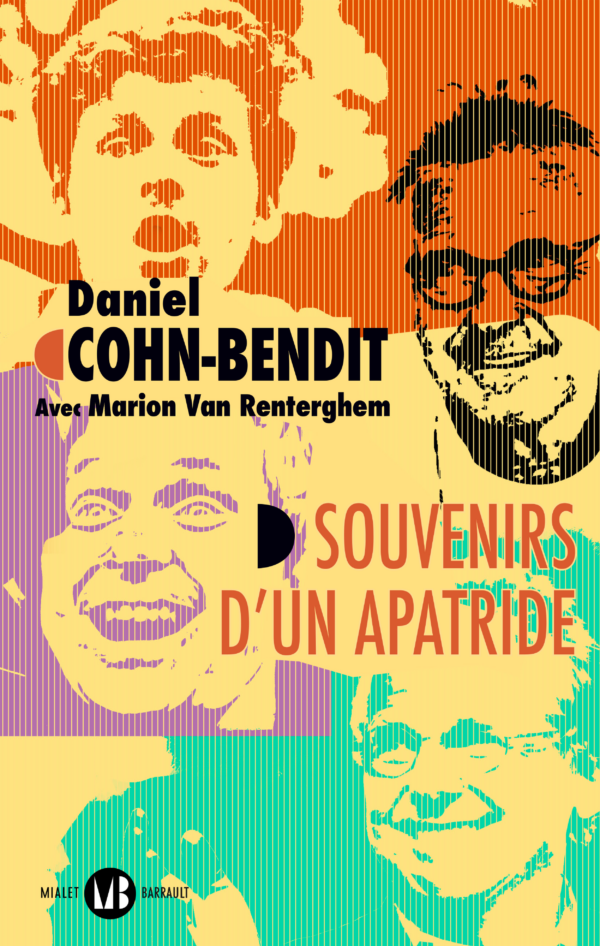
Daniel Cohn-Bendit
Marion Van Renterghem
Souvenirs d’un apatride
232 S., brosch.
ISBN: 978-2080469670
Mialet-Barrault Éditeurs, Paris 2025
Bestellen
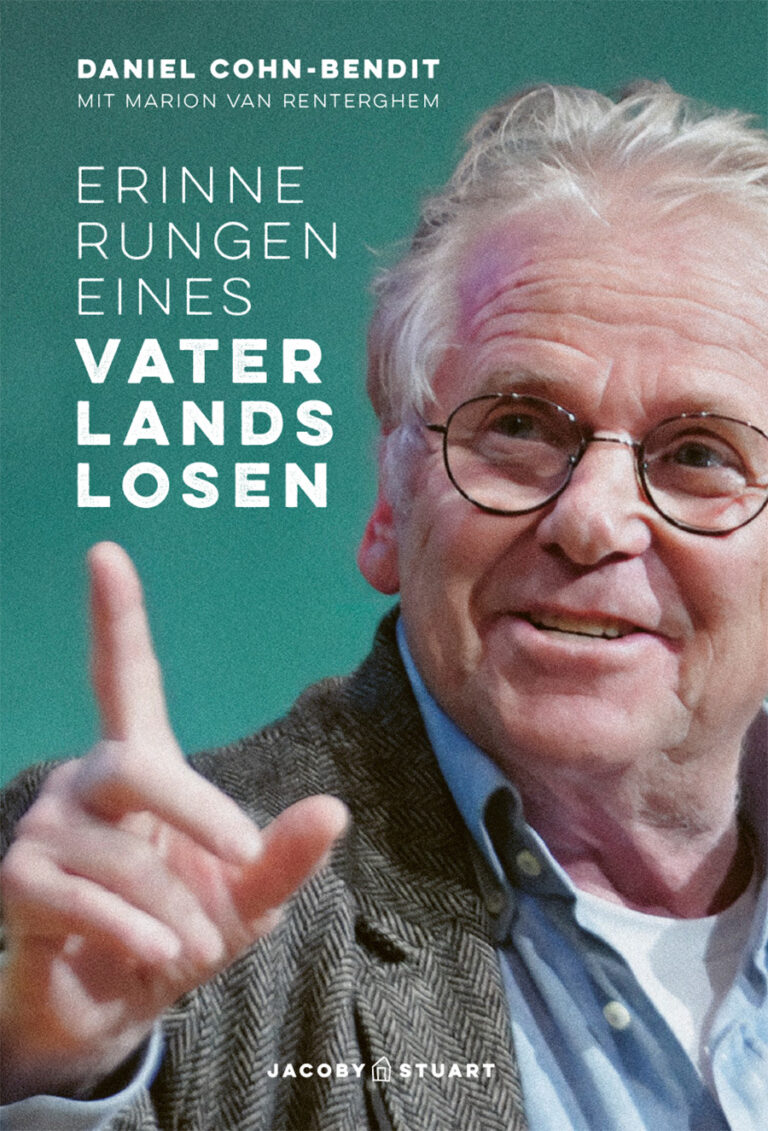
Im März 2026 erscheint das Buch in deutscher Übersetzung:
Daniel Cohn-Bendit
Marion Van Renterghem
Erinnerungen eines Vaterlandslosen
Aus dem Französischen
von Petra Willim
240 Seiten | 14,2 x 21 cm
geb., Hardcover | ISBN 978-3-96428-312-2
Jacoby & Stuart, Berlin 2026
Erstellungsdatum: 26.04.2025