


 MENU
MENU
Kurt Drawerts „Alles neigt sich zum Unverständlichen hin“

„Der Ton, in dem ich mit mir spreche, kränkt mich zutiefst.“ – Es sind solche abgründig-komischen Sätze, die man mit einiger Sicherheit Kurt Drawert zuschreiben kann. Sein jüngstes Buch ist ein großes Gedicht in 14 Paragrafen und Fotos vom Odenwald und von Kalifornien. Es ist von großer Ernsthaftigkeit und gerade deshalb am Rande der Absurdität. Die Lyrikerin Julia Grinberg ist durch das Werk gegangen.
„Alle Kunst kommt vom Fleisch“ schrieb Alfred Hrdlicka. So stand es in Vorwort zur Ausstellung einiger seiner Werke. Als ich es las, spätestens ab da, hatte ich meiner Sprache (meinem heiligen Geist) gewährt, beim Körper zu bleiben. Diese persönliche Genehmigung war von mir hart erkämpft, an vielen anderen Orten (des Sprechens, des Schreibens) findet der Kampf immer noch statt.
Im Gedichtband „Alles neigt sich zum Unverständlichen hin“ von Kurt Drawert ist dieser Widerstand, diese Dichotomie Geist vs Körper, zerlegt und auf philosophisch eleganteste Art wiedervereint. Auf den ersten Blick ist dem gar nicht so: „Eine Fliege kämpft mit dem Elend. Auch sie, ganz ohne Beistand, ohne letztes Gebet“. Aber nur auf den ersten.
In diesem Buch werden sowohl abstrakte, als auch existenziell notwendige Dinge analysiert. Drawert spricht über Sprache als Symbol und – über Körper, ganz im Sinne Hrdlickas. Über Schein und Sein, Mangel und Nichts. Über Profanes der Gesellschaft, wobei er es so umerzählt, dass das Profane wiederum zum Abstrakten wird. Auswüchse des politischen Konsumismusses werden satirisch verhöhnt. Es geht auch auf anderen Ebenen gegensätzlich zu: Es schaukelt zwischen sprachlicher Wucht und Amtseuphemismen, hier und da winkt uns das Komische zu: „Wir erinnern uns? § 3ff., wer noch einmal zurückblättern möchte. Gut erklärt.“
Der Stoff des Buches ist aus Gegensätzen dicht gewebt. Das allgegenwärtige Ideelle ringt mit absoluter Vergänglichkeit, das Transzendente mit Irdisch-Banalem, Lacanscher Mangel trifft auf Geldmangel, Ökonomie des Körpers verspottet die Ökonomie des Lebenserhalt. Drawert schafft es, Signifikantes und Arbiträres, Begehren und Verzicht, Liebe und Verwerfung, Bleiben und Gehen, Konkretes und Symbolisches in seinem eigenen Kosmos zu vereinen. Borromäische Ringe verlängern sich bei ihm zu Ketten.
Ich maße mir nicht an, mit großen Kategorien zu jonglieren, lieber zeige ich an Beispielen, wie tiefgründig und spielerisch ironisch Kurt Drawert damit umgeht:
„Dann treffen wir uns, löffeln Buchstabensuppe und reden von früher, wo die Sätze noch vollständig waren“
Der Mangel ist im Buch gegenwärtig: „Du hast zu viele meiner Worte verbraucht“, aber auch von Mangel ist nur ein Restbestand da, das dokumentiert Drawert – tragikomisch und lamentierend.
Seit einigen Jahren verfestigte sich bei mir das Gefühl, dass die unsere Welt langsam aber sicher zugrunde geht. Ich meine es jetzt nicht unbedingt apokalyptisch (ein wenig doch schon), kann sein, dass eine neue Welt sich gerade gebiert. Uns (wem?) bleibt – was?
Bitterkeit und Ratlosigkeit angesichts des Status Quo, der keiner ist. Nichts ist stabil. Alles zerfließt, zerläuft, ist nicht zu halten, der Verfall hat alles besetzt. Und doch: „Die Welt besteht aus Sprache. Ich bin ein Körper in meiner Vorstellung. Das Reale ist Existenz, an die der Körper sich stößt.“
„Ich berühre mich nicht mehr. Ich schaue nicht hin, wenn ich etwas sehe, wenn der Spiegel über mir steht“.
Der vernichtende Ton, in dem Drawert vom Körper (organisch und symbolisch) spricht, resultiert aus schmerzhafter Beobachtung des eigenen Körperzerfalls, der Scham am Sein, des Zugehörigkeitsmangels, er rechnet „werbetechnisch völlig erschöpft“ mit der Verdummung im Allgemeinen. Es gelingt ihm trotz bitterste Beschreibungen der physiologischen Aussetzer auf einer markante Distanz zum Körper zu bleiben, so dass es klar wird: Hier geht es um Geist. Teils dank Freud und Lacan, auf deren Zitate er improvisierend in seinem Text verweist, teils dank dem urkomischen Witz, in dem Tragödie und Komödie so konzentriert sind, dass es schon barock wirkt (meine Empfindung bestätigte sich am Ende des Buches, der Autor selbst spricht mal über „hochbarocken Überschuss“).
Wo wir gerade beim Barock sind, möchte ich die Optik des Textes erwähnen. Das „daktylische Grund-/muster“ soll „Herz- und Lebensrhythmus des Verfassers kopieren“. Die Strophen (meistens Terzette und Quartette) rufen Terzinen und Sonette ins Gedächtnis zurück. In der (ironischen) „Leseanleitung“ verweist Kurt Drawert außerdem auf die „gewaltige Ode an die Freude“, was den lyrischen Aufbau seines Buches angehen soll. In welch einer Diskrepanz nun aber steht Freude zu Drawertschen Gedichten? Kein Wundern – angesichts des „tosenden Lebens der Toten“.
Seine Gedichte beobachten – wie ein analytisches Instrument für den Zustand der gegenwärtigen Wirklichkeit –, halten fest, veranschaulichen, analysieren, in jeglichem Sinn. Aber sie schütteln auch den Kopf, lachen aus, lachen zum Trost.
Der Ton, in dem sich Kurt Drawert der Sprache widmet, ist oft nicht minder bitter:
„Die Sprache führt uns zu Wahrheit, sobald sie sich durch alle Täuschungen hindurchgezogen hat ... gnadenlos wahr wird die Sprache, wenn man sie lässt“.
„Ich verstehe es nicht, was in mir spricht und warum“ – er stellt die Rolle der Sprache in der Bewältigung „der aufreissenden Leere, des Nichts“ in Frage. Und siehe da: „die Erhabenheit des Unaussprechlichen“ kehrt zurück.
„Alles neigt sich zum Unverständlichen hin“ beinhaltet Bilder, an denen ich gerne kleben bleibe. Manchmal sind sie schrecklich schwer – „wie Blei fällt die Zeit aus den Bäumen“ –, manchmal umarmend warm: „Die letzten noch zuckenden Bienen retten sich in den Honig des Jahres“. Und wenn Kurt Drawert schreibt: „Ich hätte euch bessere Aussichten in Aussicht gestellt, aber die habe ich nicht zur Hand“, glaubt ihm nicht, er hat sie, zum Beispiel hier:
„Fast jeden Tag kommt eine Katze, von wilden Kämpfen gezeichnet, an meine Haustür und bietet um Einlass. ... Dann will sie, meistens, über Sartre sprechen, über Das Sein und das Nichts. ... Ich gieße ihr Milch in die Schale und erfreue mich daran, dass jetzt keiner etwas sagt“.
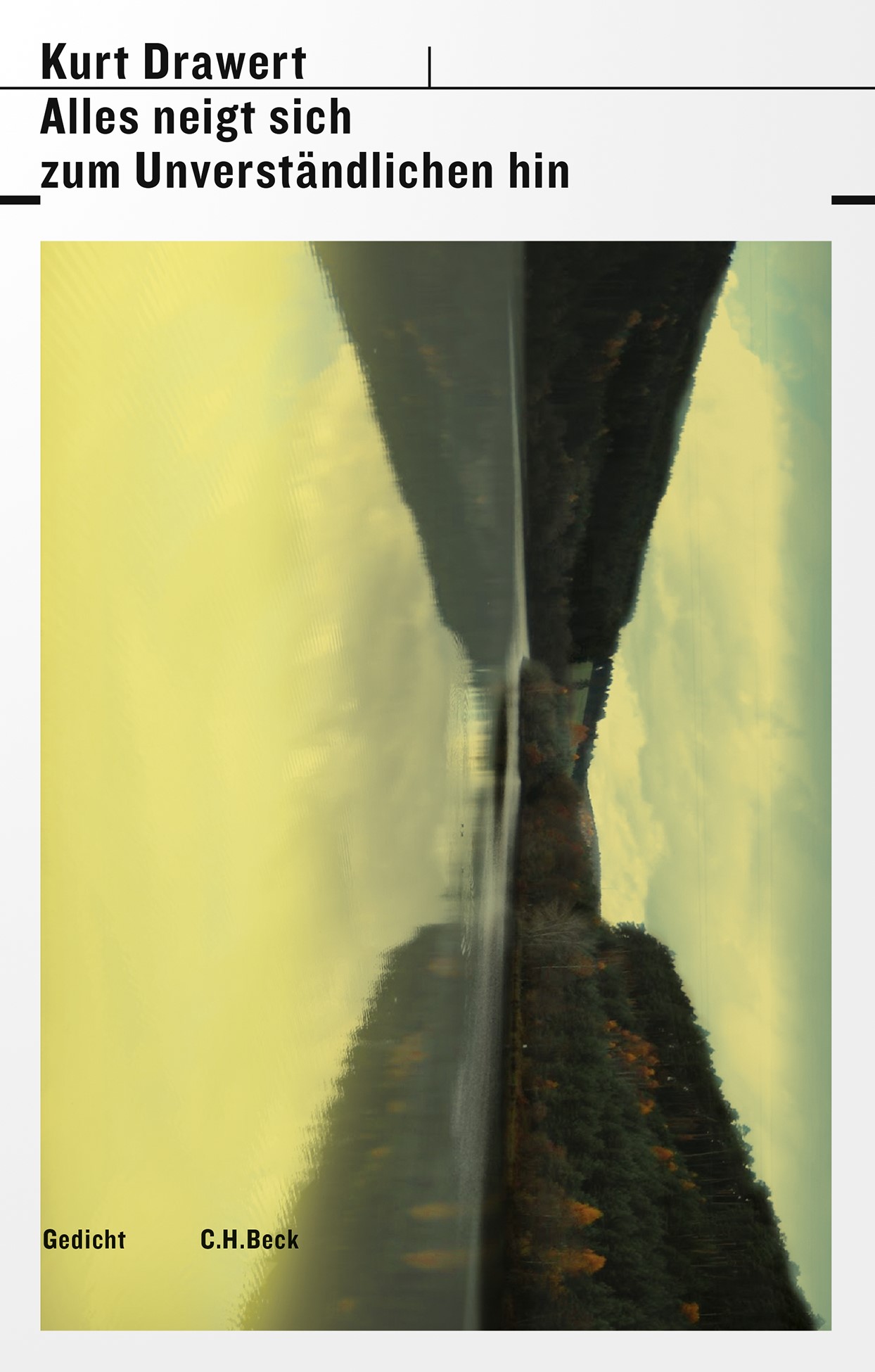
Kurt Drawert
Alles neigt sich zum Unverständlichen hin
Gedicht
176 S., geb.
ISBN: 978-3-406-81379-5
C. H. Beck, München 2024
Erstellungsdatum: 25.07.2024