


 MENU
MENU

Die Textors waren erfolgreiche Juristen. Johann Wolfgang Textor war Ratsherr, Schöffe und Bürgermeister in Frankfurt. Letztlich bekam er als Stadtschultheiß die Leitung des Justizwesens der Stadt auf Lebenszeit. Seine Tochter Catharina Elisabeth wurde als Siebzehnjährige an den 21 Jahre älteren wirklichen kaiserlichen Rat Johann Caspar Goethe verheiratet. Ein Jahr später bekam sie ihren „Hätschelhans“, Johann Wolfgang Goethe. Mit Frau Aja, wie die Mutter des Dichters genannt wurde, hatte es seine besondere Bewandtnis, wie Eva Demski zu berichten weiß.
Nie wird entschieden werden, welcher Mensch glücklicher dran ist – der Wanderer oder jener, der bleibt, der Makrokosmiker oder der Mikrokosmiker, jener, der seine Abenteuer am Küchentisch erlebt, oder der, der Meere überquert und Wüsten durchmißt. Soll man in die Welt gehen oder sie zu sich befehlen in aller Freundlichkeit? Jedermann weiß, daß Goethes Mutter, Catharina Elisabeth, geborene Textor, ein schönes Beispiel für jenes weltläufige Auf-dem Fleck-Bleiben abgibt, das in unserem Jahrhundert so verhängnisvoll abhanden gekommen ist. Daß ein Großteil des Menschenelends vermieden werden könnte, lernten diese, ruhig auf ihrem Hintern sitzenzubleiben: Der philosophischen Erkenntnis hätte die Frau Rath sich nicht verschlossen. Vielleicht hat sie sie sogar gekannt. Es gehören aber ein paar Voraussetzungen dazu, dieser Lebensweise Glanz und Fülle abzugewinnen und sie nicht in Langeweile und Spießertum erstarren zu lassen: Neugier, ein glückliches Temperament und ein Sendbote, ein Teil seiner selbst, den man in die Welt schickt. Mit achtzehn Jahren hat sie ihn geboren, diesen Sendboten, der in die Welt gehen sollte mehr als andere, mehr sehend, als andere je sehen würden, und sie hat ihn vom ersten Augenblick an geliebt. Er wird einmal von seiner Mutter sagen, daß diese alles ertragen könne, nur keine Sorgen. Das ist eine hinterlistige Bemerkung und sie bezeichnet, was beim ersten Anschauen der von Klischees wie von ihren Hauben bedeckten Frau Rath als leises Mißbehagen aufscheint: Es kann doch nicht angehen, daß ein Mensch immer nur gut gelaunt, heiter, menschenfreundlich, unerbittlich lebensklug wie sie, kurz gesagt, für einen Alltagsmenschen unausstehlich ist? „Es widerstrebt uns“, sagt Alfons Paquet in einem klugen Satz, „das Vergangene zu idealisieren, nur weil es uns nicht mehr weh tut.“ Vielleicht trübt die Sehnsucht nach dem, was Frau Aja verkörpert, den Blick, vielleicht schaut man diese Frau nur an, nachdem sie sich des Frauseins begeben hat, eine Art Kachelofen geworden ist, familiäre Wärmequelle und ungefährliche Freundin. Ihr Sohn, jedenfalls, kommt ihr oft jahrelang, vor ihrem Tod mehr als zehn Jahre, nicht in die Quere. Sie drängt ihn nicht. Nicht einmal den Fehler macht sie.

Was wissen wir über Catharina Elisabeth, die Frau Rath, die Frau und Mutter Aja, wie sie Freunde nach der Mutter der Haimonskinder nennen? Mit siebzehn Jahren wird sie mit dem einundzwanzig Jahre älteren kaiserlichen Rat Johann Caspar Goethe verheiratet. Ihr Vater Textor hatte ihr, das war ihr Glück, eine Erziehung „ohne Schnürbrust“ angedeihen lassen. Denken kann sie und reden, und die Ehe mit Goethes Vater, der in der Literatur oft nicht gut wegkommt und als Knauser und Eigenbrötler dargestellt wird, war in Wirklichkeit sicher nicht unangenehm, die äußeren Bedingungen mehr als erträglich. Das Haus am Hirschgraben ist ja heute nur noch Erinnerung. Aber die Beschreibungen und Darstellungen sind zahlreich, mit Hilfe derer man dem wiederaufgebauten Haus Leben einhauchen kann. Siebenundvierzig Jahre wird sie darin verbringen und es im Alter ohne Bedauern zugunsten eines bequemeren Logis verlassen. Das Haus also: Das ist beschaubar, wenn auch nachgeahmt. Ihr Grab – heute auf einem Schulhof, nahe der Peterskirche. Ihr Frankfurt, in Resten. Die Werke ihres Sohnes, denen auf Augenhöhe sich zu nähern allerdings kaum jemand wagt.
Etwas über vierhundert Briefe, die von ihr erhalten sind, lassen sie nahekommen. In diesen Briefen, aber auch in den Erzählungen und Berichten ihrer Freundinnen und Freunde ist das Geheimnis ihrer Lebenskunst verborgen, wobei an Aja nichts Verfeinertes – in ihrer Lebenszeit üblich –, modisch Gestelztes zu finden ist. Sie hat, so scheint es, trotz mancher Schmerzen und vieler Begegnungen mit dem Tod, einfach gern gelebt. Sie wußte, daß man sich zunächst selber gut sein muß, um für andere eine Freude zu sein. Säuerliche Wohltätigkeit mit dem Schielauge auf himmlischen Lohn war nicht ihre Sache, wobei ihr Glaube durchaus ein Zentrum ihres Lebens war. Aber über einen Pfarrer in der nahen Kirche sagte sie, seine Predigten seien es nicht wert, ein warmes Bett am Sonntagmorgen dafür einzutauschen. Elisabeth Goethe bekommt nach ihrem Hätschelhans noch fünf Kinder, aber nur Cornelia erreicht ein unglückliches Erwachsenenalter, die anderen vier sterben ganz klein. Auf einem Porträt, das die Familie hübsch gravitätisch, aber auch stolz zeigt, stehen im Bildhintergrund die toten Kinder als Genien. Obwohl die Kindersterblichkeit damals hoch war und fast jede Familie es erlebt hat, ein oder mehrere Kinder früh zu verlieren, wäre es falsch anzunehmen, das sei damals kein ebenso entsetzlicher Schmerz wie heute gewesen. Der Glaube allein sorgte für die Ergebenheit ins Unabänderliche.
„Wer wird sich grämen, daß nicht immer Vollmond ist, und daß die Sonne jetzt nicht so warm macht wie im Julius – nur das gegenwärtige gut gebraucht und gar nicht dran gedacht, daß es anders seyn könnte; so komt mann am besten durch – und das durchkommen ist doch/ alles wohl überlegt/ die Hauptsache ...“
Als sie das an ihre geliebte Herzogin Anna Amalia schrieb, war sie schon über fünfzig – aber sie scheint von Anfang an in dieser gelassenen Bescheidung gelebt zu haben. Von Stürmen in ihren jungen Jahren wissen wir nichts, das heißt aber nicht, daß es keine gegeben hat. Eine leidenschaftliche und sinnliche Natur wie sie, dazu schon früh in einer unangefochtenen gesellschaftlichen Position, ohne den Konkurrenzkampf um die „besseren Partien“ und ohne Angst, überhaupt keine Partie zu machen, dazu mit dem Glück einer liberalen Erziehung – es ist eigentlich undenkbar, daß ihr nicht irgendein Prinz von den Wanderbühnen und Gemütsstücken, die sie so gern hat, in die Augen oder ins Herz geraten ist – aber wir wissen es nicht, das heißt, die einzige Seelenverwirrung, die uns bekannt ist, widerfährt ihr in viel späteren Jahren. Die vergehende Zeit hat ihre eigene Diskretion. Eine junge Frau, die einem großen Haus vorsteht, die gern Kleider und Putz kauft und einen etwas lehrhaften Gatten zu ertragen hat, die ihr Frankfurt liebt und den gekrönten Häuptern zuschaut, die Besuche macht und empfängt und deren Leben sich erweitert und anders zu blühen beginnt, als die Karriere des Sohnes auch sie mit auf die Planetenbahn nimmt. Freunde waren ihr immer wichtig, auch die Freunde der Kinder. Mit ihnen korrespondiert sie, schickt Geschenke und Süßigkeiten, und je berühmter der Sohn wird, desto mehr schreibt sie gleichsam „um ihn herum“. Goethe hat die Briefe seiner Mutter aus der frühen Zeit nicht aufgehoben, warum, ist nicht bekannt. Jenes tausendfach untersuchte und interpretierte, ausgeleuchtete und umgewendete Leben Goethes birgt, was das Verhältnis zur Mutter betrifft, Geheimnisse. Warum hat er sie so selten besucht, warum eigentlich sich nie ihr direkt zugewendet, sondern immer nur verbunden mit anderen Pflichten, die ihn nach Frankfurt führten? Sie beklagt sich nicht. Sie macht keinen der bekannten Mütterfehler und Klammerszenen, soweit wir wissen, sie ist diejenige, die selbst seine unverständlichsten Entschlüsse klug und energisch verteidigt. Dennoch muß sie die meiste Zeit ihres Lebens mit seinem Abglanz zufrieden sein. Aber sie weiß wohl, daß dieser Abglanz mehr ist und wärmer macht als die unmittelbare Nähe durchschnittlicher Menschen. „Mir ist nur immer vor dem Verrosten bange, wenn man genöthigt ist mit lauter schlechten Leuten umzugehen, so ist 1000 zu 1 zu wetten, daß wenn mann nicht genau auf sich acht gibt – auch schlecht wird.“ Darüber hatte sie nicht zu klagen. Ihr Mann wurde zwar älter und pflegebedürftig, aber das nimmt sie auf sich, und Lavater, Wieland, Merck, Seidel und wen der Kreis auch enthält, lenken sie ab. Frau Aja hat ein wunderbares Talent, sich zu freuen. Auch kleine und größere Koketterien sind ihr nicht fremd, so, wenn sie Lavater in einem Postscriptum ganz beiläufig bittet: „Wan es Euch möglich uns von des Docters seinem in kupper gestochenem gesicht noch einige Abdrücke zu kommen zu lassen; so würden wir hertzlichen Danck davor sagen, die Leute plagen uns beständig und wollen so was zum Andencken haben“ – oder wenn sie sich der Madame de Staël, die sie nicht leiden kann, mit den Worten vorstellt „Je suis la mère de Goethe".
Was wissen wir über die Frau Rath? Und was wollen wir wissen? Ihre jungen Jahre sind vorbei, und sie scheint das überhaupt nicht zu bedauern. Der erste erhaltene Brief datiert von 1774 da ist sie immerhin schon 43 Jahre alt, eine Matrone, hineingewachsen in die Rolle der Mutter, die sie, schenkt man ihr Glauben, mit dem ersten Schrei ihres Sohnes und selbst noch ein Kind, voller Begeisterung angenommen hat. Es gibt Frauen, die erst in den späteren Jahren ganz sie selbst werden und die erst dann ihre Geschenke an die Gesellschaft verteilen: Witz, Unbestechlichkeit des Urteils, Stärke und Selbstiro- nie – von alldem hat die Frau Rath eine Menge und kann als reife Frau sich und anderen ein Vergnügen sein. „Ich befinde mich Gott sey Danck gesund, vergnügt und fröligen Hertzens – suche mir mein bisgen Leben noch so angenehm zu machen als möglich – Doch liebe ich keine Freude, die mit unruhe, wirrwar und beschwerlichkeit verknüpft ist – den die Ruhe liebte ich von jeher – und meinem leichnam thue ich gar gern seine ihm gebührendte Ehre ...“ Die Orthographie der Frau Rath ist eine eigene Sache, und das hat weniger mit der noch nicht so reglementierten Rechtschreibung der damaligen Zeit zu tun als mit ihrem Temperament, das sie fröhlich alles so hinschreiben heißt, wie es ihr grade am besten klingt. Zu verstehen ist es allemal. Sie sei tintenscheu, sagt sie zwar, aber in ihren späteren Jahren ist davon nichts zu spüren. Sie platzt förmlich heraus, vor allem in ihren Briefen an Anna Amalia, die ihr wegen der Nähe zum vergötterten „Docter“ mit zusätzlichem Glanz umgeben scheint.
Aja hat ein Talent, Erinnerungen als Schatztruhen zu begreifen, als Vorrat für ereignislose Tage – auch das ist ein Schlüssel zu ihrem glücklichen Gemüt. Die Erinnerungen an die Besuche der Durchlauchten sind besondere Juwelen in diesem Schatz, und sie nimmt sie immer wieder heraus, betrachtet und poliert sie, „mann kan hernach immer wieder was auf den Rücken nehmen und durch diese Werckeltag Welt durchtraben und sein Tagewerck mit Freuden tun, wenn einem solche Erquickungsstunden zutheil worden sind“. Sie vergißt nie, immer wieder einen Dank an Gott in ihre Briefe zu flechten, aber, trotz ihrer Verbindung zu pietistischen Kreisen, niemals bigott oder mit jener ranzigen Frömmigkeit, die damals im Schwange war und die Sinnenangst verdecken sollte, sondern mit einer Art von erstaunter Fröhlichkeit. Den Fehler, über das Wesen des Glaubens nachzugrübeln und sich „ein Bild zu machen“, begeht sie nicht. „... so habe ich heilig geschworren, mich mit meinem Maulwurfs Gesicht in gar nichts mehr zu meliren, und zu mengen, es immer einen Tag dem andern sagen laßen, alle kleinen Freuden aufzuhaschen, aber sie ja nicht zu anatomiren – Mit einem Wort – täglich mehr in den Kindersinn hineinzugehn, denn das ist Summa Summarum doch das wahre, wozu mir dann Gott seine gnade verleihen wolle Amen.”
1786 verschwindet der Sohn, zum Erstaunen aller, zum Unwillen des Hofs in Weimar, zur Bestürzung und Fassungslosigkeit der Freunde. Keiner weiß, wo er ist, keiner weiß, was er plant. So jung er ist, so bekannt und gesucht ist er auch schon. Als die Räthin endlich durch einen Brief von ihm erfährt, daß er sich auf die Reise nach Italien begeben hat – der Wirklichkeit jener Kupferstiche nach, die ihm schon als Kind im Haus am Hirschgraben den allergrößten Eindruck gemacht haben –, da ist es seine Mutter, die ihn von allen am besten versteht, ganz naiv, direkt und freundlich. Sie räsonniert nicht wie die Stein, sie begreift instinktiv, daß er, vom Ruhm auch bedrängt, sich die italienische Luft hat verschaffen müssen. „Einen Menschen wie du bist, mit deinen Kentnüßen, mit dem reinen großen Blick vor alles was gut, groß und schön ist, der so ein Adlerauge hat, muß so eine Reiße auf sein gantzes übriges Leben vergnügt und glücklich machen – und nicht allein dich sondern alle die das Glück haben in deinem Wirckungs kreiß zu Leben.“ Später im gleichen Brief setzt sie ruhevoll und selbstbewußt ihre Art zu leben dagegen: „Tausend würde so ein Leben zu einförmig vorkommen mir nicht, so ruhig mein Cörpper ist; so thätig ist das was in mir denckt da kan ich so einen gantzen geschlagenen Tag gantz alleine zubringen, erstaune daß es Abend ist, und bin vergnügt wie eine Göttin –”
Einmal, Ende der achtziger Jahre, ist es für ein paar Monate mit ihrer schönen inneren Ruhe vorbei. Sie, die große Verehrerin des Theaters, die sich am liebsten jeden Tag eine Vorstellung angeschaut hätte, verliebt sich in den Schauspieler Karl Wilhelm Unzelmann, der mit der Großmannschen Truppe nach Frankfurt gekommen war. Unzelmann war zwanzig Jahre jünger als seine Verehrerin, aus deren Briefen hervorgeht, daß sie nicht wußte, wie ihr geschah. Daß ihr ruhiges und fröhliches Lebensschiff so ins Schlingern gekommen ist, kann sie nicht fassen, und sie reagiert mit jenem ungeschützten Schmerz, wie ihn Kinder haben. Wir wissen nicht, wieviel Kraft es sie gekostet hat, von diesen Gefühlen zu lassen. Wir wissen nichts über ihre Sexualität, wir haben jene Bilder vor Augen, auf denen sie, wie Alfons Paquat verzweifelt schreibt, immer „diesen fatalen Turban“ aufhat. Er meint natürlich jene Hauben, die alle Frauengesichter so gleichmütig und geschlechtslos, eben mütterlich aussehen ließen. Aber der Ton ihrer Briefe an Unzelmann, als dieser, wegen seiner Unzufriedenheit mit den Frankfurter Bedingungen, nach Berlin gegangen war, ohne sich von seiner Freundin und Gönnerin zu verabschieden, zeigt, daß sie diesem Mann mehr von sich preisgegeben hatte, als sie vielleicht selber wußte. „Ich weiß warrlich nicht, ob ich nach so vielen vorangegangenen Täuschungen, fehlgeschlagenen Erwartungen, mein Hertz der Hoffnung, die mich so offte, so unendlich offte hintergangen hat, ob ich dieser Betrügerin es je wieder öffnen soll: oder ob es nicht beßer ist sie gantz zurück zu weißen, keinen strahl mehr davon in die Seele kommen laßen – und mein voriges Pflanzenleben wieder anzufangen – ich sage es noch einmahl – ich weiß es nicht. Die Quall die ich jetzt leide ist unaussprechlich –“
Sie hat es sich, so scheint es, aus dem Herzen gerissen. Die zwanzig Lebensjahre, die ihr noch beschieden sind, verbringt sie mit Gelassenheit, klaren Blicks älter und schließlich alt werdend.
Mitte der neunziger Jahre verkauft die Frau Rath das Haus im Hirschgraben, in dem sie siebenundvierzig Jahre verbracht hat. Die Auflösung des Haushalts, die Katalogisierung der Bücher, die Suche nach einem Käufer einerseits und nach einer neuen Wohnung andererseits ziehen sich hin, denn wenn auch das Haus im Hirschgraben als eines der schönsten in Frankfurt gegolten hatte – die Zeiten hatten sich geändert und der Anspruch auf Luxus oder zumindest Bequemlichkeit war gestiegen. Diesen Anspruch an ihr neues Zuhause hat die Räthin auch, denn: „Im fünften Akt“, so sagt sie über ihr Alter, „soll applaudiert und nicht gepfiffen werden.“ Sie nimmt schließlich Wohnung im Haus zum Goldenen Brunnen am Roßmarkt, schickt Briefe, „Bissquittger“, Eßkastanien, Handschuhe und Tand in alle Welt, freut sich über die wachsende Zelebrität des Sohnes und hütet sich, irgendwelche Zwänge auszuüben oder Forderungen an die nachfolgenden Generationen zu stellen. Schon früher war sie dem Geheimnis des Glücks auf der Spur gewesen – an Frau von Stein hatte sie 1785 geschrieben: „Zwar habe ich die Gnade von Gott, daß noch keine Menschenseele mißvergnügt von mir weggegangen ist – weß Standes, alters und Geschlecht sie auch geweßen ist. Ich habe die Menschen sehr lieb. „Ihr Tod kam sanft, am 13. September 1808. Alle Quellen berichten, einem Boten, der ihr eine Einladung habe überbringen sollen, sei von der Räthin ausgerichtet worden, sie lasse sich entschuldigen, sie müsse alleweil sterben. Auf dem Peterskirchhof wurde sie begraben, und ihr Grab ist heute an einer Schulwand, in einem abgesperrten Schulhof. Hier „ruhet sie“ nun – Goethes Mutter. Kein schlechter Platz, trotz allem.
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.
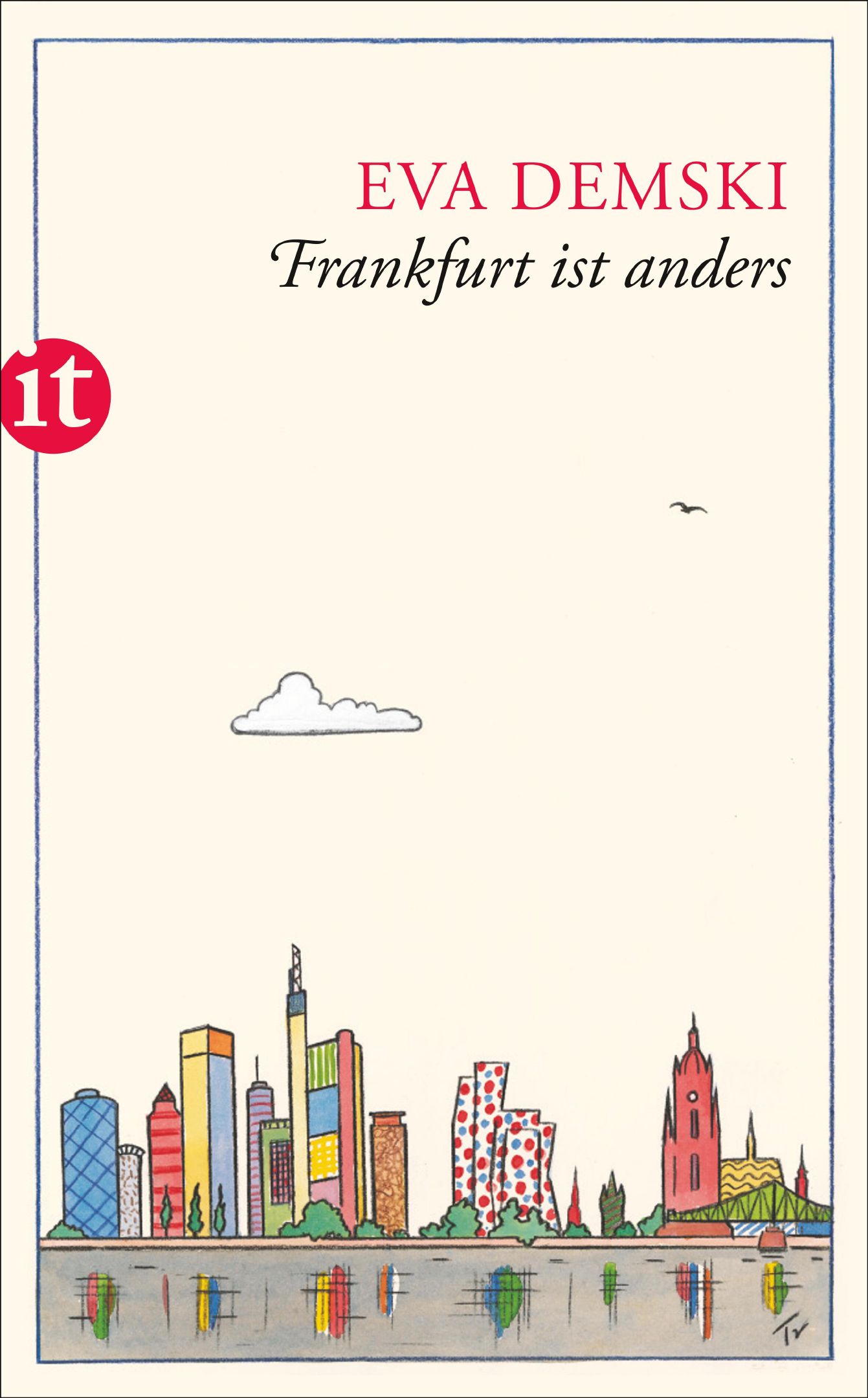
Eva Demski
Frankfurt ist anders
Mein Stadtplan
Hrsg. von Wolfgang Schopf
Insel taschenbuch 4278
Insel-Verlag, Berlin 2014
Erstellungsdatum: 10.08.2024