


 MENU
MENU
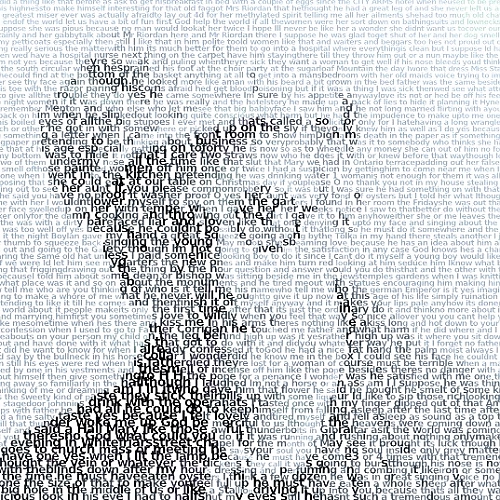
Wie viele unserer rätselhaft gewordenen Wörter stammt „Avantgarde“ aus längst vergangener Zeit, als, zu Pferd oder ohne, Stoßtrupps todesmutig gegnerische Kommandeure attackierten und die Schwachstellen des Feindes einnahmen, bevor das Heer nachrückte. Die Verwendung der militärischen Vokabel in den Künsten hatte allerdings schnell ihren tieferen Sinn eingebüßt, als man gewahr wurde, dass kein Heer mehr nachrückte. Seitdem kämpft die Avantgarde um die Listenplätze der Innovation. Rolf Schönlau erinnert an die Bedeutung der klassischen Avantgarde.
Ein Titel mit Widersinn, denn Klassik und Avantgarde scheinen so wenig zusammenzupassen wie Bewahrer und Neuerer. Wie kann das Infragestellen vorherrschender politischer und künstlerischer Normen – das, was die Avantgarde ausmacht – mustergültig und nachahmenswert sein, eben klassisch? Eine zeitlose Wahrheit braucht keine Vorhut, die die Menschen mit innovativen Ideen und neuen Theorien konfrontiert.
Nun werden solche Redefiguren aber verwendet, um auf komplexe Zusammenhänge hinzudeuten. In diesem Falle darauf, dass die Avantgarde, die in den Jahrzehnten vor und nach der vorletzten Jahrhundertwende am Beginn der Moderne stand, historisch geworden ist. Eine abgeschlossene Epoche, wie die Moderne selbst, die spätestens nach dem Auftauchen des Begriffs der Postmodere ebenfalls gern als klassisch bezeichnet wird.
Ein kurzer Blick auf die Architektur als Sparte, die hier nicht behandelt werden soll, zeigt einen erstaunlichen Zusammenklang des Klassischen mit der Avantgarde. Der österreichische Architekt Adolf Loos, von dem die berühmte Formulierung ‚Ornament und Verbrechen‘ stammt, entwarf 1922 für einen Wettbewerb um den Hauptsitz der Tageszeitung Chicago Tribune einen Wolkenkratzer in Form einer dorischen Säule. Über einer elfstöckigen quadratischen Basis sollten sich 21 Stockwerke mit Büros erheben. Die Bürofenster lagen in den Kanneluren des Säulenschafts. Den oberen Abschluss bildete ein Kapitell mit Wulst und quadratischer Deckplatte. Bis hin zur Schwellung des Schafts waren alle Merkmale der dorischen Säulenordnung versammelt, wie sie schon der römische Architekt Vitruv im 1. Jh. v. Chr. beschrieben hatte. Dennoch war der Entwurf, der nie realisiert wurde, avantgardistisch: Eine Säule, die kein Gebäude trägt, sondern selber das Gebäude ist.
Dass die drei zu den Großkünstlern ihrer Epoche zählen, steht außer Frage. Aber warum nicht Schönberg, Baudelaire und Malewitsch, um eine andere Troika zu nennen, die ebenso gut für die Musik, Literatur und bildende Kunst der klassischen Avantgarde stehen könnte? Ein Grund für die Auswahl liegt in den Biographien begründet, die ein Beispiel für den Internationalismus der Avantgarde abgeben. Satie war Franzose und blieb zeitlebens in Paris. Joyce war Ire und ging nach Triest mit seiner kosmopolitischen Bevölkerung aus Italienern, Slawen und Österreichern, dann nach Zürich, dem Schmelztiegel der Avantgarde, politisch Lenin und künstlerisch Dada, und natürlich nach Paris. Marcel Duchamp war Franzose, wurde nach dem 2. Weltkrieg Amerikaner und pendelte Zeit seines Lebens zwischen Paris und New York. In seiner Biographie spiegelt sich die Ablösung von Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts durch New York als Hauptstadt des 20. Jahrhunderts.
Ein weiterer Grund sind die jeweiligen Lebensverhältnisse: Satie hatte ständig Geldsorgen und hielt sich als Pianist in Kabaretts am Montmartre recht und schlecht über Wasser. Joyce musste jahrzehntelang Englischunterricht als Brotberuf geben, bevor die Verlegerin, Feministin und reiche Erbin Harriet Shaw Weaver seine Mäzenin wurde. Duchamp stammte aus einer wohlhabenden Familie, konnte schon immer von seiner Kunst leben und heiratete später die Enkelin eines reichen Automobilfabrikanten. Kurz, die drei spiegeln die ganze Bandbreite des Bohemien-Lebens. Exzentrisch war einer wie der andere.
Satie nannte sich Gymnopädist, noch bevor er seine Gymnopédies komponiert hatte. Das Wort bezieht sich auf die Tänze der Jünglinge im antiken Sparta um eine Apollo-Statue herum. Der Musiker war ein Messie und lebte jahrzehntelang in einem kleinen Zimmer in Arcueil bei Paris. Die gut 20 km zum Montmartre ging er täglich zu Fuß. Seine Spielanweisungen sind legendär: „Gehen Sie nicht höher. Vergraben Sie den Ton. Tanzen Sie innerlich. Öffnen Sie den Kopf.“
Joyce hatte Hunderte von winzigen Zetteln in seinen Anzug- und Manteltaschen stecken, auf denen er sich alles Mögliche notierte, etwa die Wörter für Donner in zehn verschiedenen Sprachen von Madagassisch bis Gotisch, aus denen dann das berühmte Donnergrollen in Finnegans Wake komponiert wurde: „bababadal-gharaghtakam-minarronn-konnbronnton-nerronntuonn-thuuntrovarr-hounawnskawn-toohoohoorden-enthurnuk“.
Duchamp umgab sich ein Leben lang mit einer Entourage von Exzentrikern. Er wohnte im selben Haus wie die New Yorker Dada-Queen Elsa Freytag-Loringhoven, die 1915 mit einer blinkenden Rückleuchte am Gesäß und fünf Hunden an einer vergoldeten Leine auf die Straße ging. „Autos und Fahrräder haben Rücklichter“, sagte sie in einem Interview mit der New York Times, „warum nicht ich?“
Und dann ist da noch John Cage, selbst Avantgarde-Musiker, der in einem Text sagt, dass „die Werke von Joyce, Duchamp und Satie auf je verschiedene Weise der Verstehenshuberei widerstanden haben und folglich frisch sind wie am ersten Tag.“
Trotz des großen Beharrungsvermögens im allgemeinen Musikgeschmack ist Satie, wenn nicht im Konzertsaal, so doch im Film angekommen. Wenn lässige Melancholie und philosophische Langeweile angedeutet werden sollen, sind seine Stücke in weit über 100 Filmen das Mittel der Wahl als Klangtapete. Ein Begriff, gegen den Satie vermutlich nichts einzuwenden hätte, bezeichnete er seine Musik doch selbst als „Musique d’ameublement“ – Möblierungsmusik. Musik soll demnach im Raum sein wie ein Tisch, ein Stuhl oder ein Vorhang. Gymnopédie 1 hat es in der Werbung fast zum Ohrwurm gebracht: Man denke an die erste Version des Jever-Mannes im Trenchcoat, der sich in den Dünen fallen lässt, oder an die Württembergische Versicherung, die dank Saties federleichtem Soundtrack zum Fels in der Brandung wird, der allen Gefahren des Alltags trotzt.
Ob Theodor W. Adorno das meinte, als er sagte: „In den schnöden und albernen Klavierstücken Saties blitzen Erfahrungen auf, von denen die Schönbergschule nichts sich träumen lässt.“ Oder hatte der Großkritiker eher den therapeutischen Nutzen von Saties musikalischen Miniaturen im Sinn. „Monsieur!“ schrieb eine Frau in einem Brief, den Satie vermutlich selbst lancierte, „seit acht Jahren leide ich an Nasenpolypen, kompliziert durch ein Leberleiden und rheumatische Schmerzen. Nach vier- oder fünfmaliger Anwendung Ihrer Dritten Gymnopédie war ich vollständig geheilt. Nehmen Sie meine ergebensten und dankbaren Grüße entgegen. Frau Lengrenage, Tagelöhnerin in Précigny-les-Balayettes“.
Haben die Gymnopédies von 1888 ihren Avantgardestatus verloren, so gilt das nicht für die fünf Jahre später entstandenen Vexations. Ein Klavierstück mit einer Partitur, die auf einem einzigen Notenblatt Platz hat. Satie schreibt in der Spielanweisung: „Um dieses Motiv achthundertvierzigmal zu spielen, wird es gut sein, sich darauf vorzubereiten, und zwar in größter Stille, mit ernster Regungslosigkeit.“ Vexations wäre vielleicht unbekannt geblieben, hätte nicht John Cage das Stück 1949 zufällig entdeckt und 1963 in New York mit einem Team von mehreren Pianisten, darunter Cage selbst, von 18.00 Uhr abends bis 12.40 Uhr am folgenden Tag uraufgeführt. Die Aufführungsdauer variiert seitdem je nach Interpretation zwischen 12 und 28 Stunden.
Zu James Joyce: Ist man an einem 16. Juni in Dublin unterwegs – der Tag, an dem der Ulysses spielt – könnte man meinen, Joyce wäre im Mainstream angelangt. Tausende von Ulysses-Fans bevölkern die realen Schauplätze des fiktiven Geschehens von 1904 und kaufen, möglichst im Outfit von Leopold Bloom, der Hauptfigur des Romans – pünktlich, wie es im Buche steht – ein Stück Zitronenseife in Sweny’s Shop am Lincoln Place oder bestellen ein Gorgonzolabrot und ein Glas Burgunder bei Davy Byrne’s in der Duke Street. Damit all die Leopolds, Mollys und Stephens zur rechten Zeit vor Ort sind und die passende Textstelle zur Hand haben, gibt es interaktive Stadtpläne. Dublin Marketing leistet ganze Arbeit rings um den seit 1954 gefeierten Bloomsday.
Ein Blick auf den Amazon Bestseller-Rang seiner wichtigsten Werken ergibt ein anderes Bild. In der Reihe Penguin Modern Classics steht der Ulysses ungefähr auf Rang 10.000, die Dubliners auf 35.000 und Finnegans Wake auf 65.000. Bei den deutschen Übersetzungen als Suhrkamp Taschenbuch rangiert Ulysses auf Rang 45.000, Dubliners auf 50.000 und Finnegans Wake auf 450.000 – die Diskrepanz zur Muttersprache ist sicher darauf zurückzuführen, dass das Buch als extrem schwer zu übersetzen bis unübersetzbar gilt.
Wenn es darum ginge, eine Liste der berühmteste Romane des 20. Jahrhunderts zu erstellen, käme der Ulysses vermutlich, zusammen mit Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, auf einen der vorderen Plätze. Zugleich ständen beide Werke wohl auch ganz vorne in einer anderen Liste – dem Verzeichnis der berühmtesten ungelesenen Bücher. Finnegans Wake würde den Ulysses da noch einmal um Längen schlagen, denn Joyces Spätwerk ist so berühmt, dass man sich fast damit brüsten kann, es nicht gelesen zu haben. Was gekauft und vielleicht auch gelesen wird, sind Gesammelte Annäherungen an das Buch, Readers Guides oder Bücher mit Titeln wie How Joyce Wrote Finnegans Wake. Joyce hat seinen Avantgardestatus behalten. Sein Werk ist nach wie vor ein Fixpunkt, auf den man sich irgendwie beziehen muss, egal wie, sei es auch dezidiert negativ.
Zu Marcel Duchamp: Sein Hauptwerk ist nach wie vor anstößig – das durch museale Weihen nobilitierte Urinal oder Pissoir mit dem Titel Fountain. Die Merda d’artista, die Künstlerscheiße, die Piero Manzoni 1960 in mehrsprachig etikettierten Dosen verkaufte, erscheint dagegen geradezu niedlich.
Warum das so ist? Weil man nur einmal gegen alle Regeln verstoßen kann und Duchamp das schon 1917 tat; weil sein Kunstwerk nicht nur nicht ausgestellt wurde, sondern verschollen ist und nur noch in Repliken vorhanden ist; weil die Ausstellung, für die Duchamp das Werk unter einem Pseudonym einreichte, nur wegen dieser einen ausjurierten Arbeit noch präsent ist; weil sein Kunstwerk somit ein abwesendes Anwesendes ist; weil Kunst seitdem nur noch als abwesend d.h. verloren und nicht mehr als anwesend d.h. authentisch gedacht werden kann.
Man kann sich an dem Werk theoretisch abarbeiten und das ganze Avantgardevokabular durchdeklinieren. Duchamps Fountain ist als zentrales Werk in die Kunstgeschichte eingegangen. Die Arbeit ist zum Mythos geworden, zu einer sinnstiftenden Erzählung. Es war bereits alles versammelt, auf das sich die Kunst danach beziehen konnte: Provokation, Medienereignis, Erweiterung des Kunstbegriffs, Fragwürdigkeit der Urheberschaft, Original & Kopie, Selbstreflexion des künstlerischen Prozesses.
Die Welterklärung, die der Mythos nach einer allgemeinen Definition bietet, ist bei Duchamp eine Erklärung der Kunst nach dem Verlust ihrer Selbstverständlichkeit. Nichts ist mehr einfach so: Ein Artikel aus der Sanitärabteilung kann ein Kunstwerk sein, wenn er dazu gemacht wird. Wenn man ihn dazu machen will, muss man die Bedingungen, unter denen die Wandlung stattfinden kann, verstehen und herstellen. Nach der Wandlung besitzt der ehemalige Alltagsgegenstand einen Bedeutungsüberschuss. Aus einem profanen wird ein kultischer Gegenstand. Diese Wesensverwandlung oder Transsubstantiation ist ein im Grunde genommen religiöser Akt. Das ist der Kern des „Mythos Avantgarde“ – Mythos nicht im Sinne eines Irrglaubens, den man durchschaut hat, sondern in seiner ursprünglichen Bedeutung.
Erstellungsdatum: 28.10.2025