


 MENU
MENU

„Frieden ist die einzige Option“ versammelt die wichtigsten Reden und Essays des israelischen Autors David Grossman vor und nach dem 7. Oktober 2023, beginnend mit seinem Appell bei der Münchner Sicherheitskonferenz von 2017, sich für Frieden im Nahen Osten einzusetzen. Alexandru Bulucz hat sie gelesen.
Für seinen Einsatz für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern wurde der Romancier und politischer Essayist David Grossman mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und Joachim Gauck wies in seiner Laudatio darauf hin, dass Grossmans Israel-Loyalität und Israel-Kritik nicht gegensätzlich seien, sondern einander bedingten.
Auch in der jetzt erschienenen Sammlung von sieben politischen Reden und Essays halten sich eine Affirmation Israels als „Heimstatt des jüdischen Volkes“ und scharfe Kritik an der Siedlungspolitik und der Netanjahu-Regierung die Waage. Grossman trägt seine Argumente in der Sorge um Israel und gegen extremistischen, fundamentalistischen und nationalistischen Eifer vor, sichtlich bemüht, für Dialog, Frieden und eine Zweistaatenlösung zu werben.

In seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz von 2017, nur wenige Tage nach einem Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanjahu, wandte er sich mehr an Europa denn an Amerika als den mächtigsten Verbündeten Israels; Trump habe die Komplexität des israelisch-arabischen Konflikts nicht durchdrungen.
„Ich bitte Sie, alles zu tun, was in Ihren Kräften steht, um die beiden Seiten zusammenzubringen und den Dialog zu erneuern, dem beide schon seit Jahren mit der seltsamen Logik der Selbstzerstörung aus dem Weg gehen. Es stehen zahlreiche Hebel zur Verfügung, die Sie beiden Seiten gegenüber ansetzen können. […] Werden Sie aktiv und kreativ.“
Vier Jahre später, infolge des gut 10-tägigen Israel-Gaza-Konflikts von 2021, trat er vor Demonstrierende in Tel Aviv und beklagte die Manipulation durch die „extremen Seiten“ und die Weigerung der Israelis, ihr „Realitätsdiktat“ aufzugeben.
„Wir, die Israelis, weigern uns immer noch einzusehen, dass die Zeit vorbei ist, in der unsere Kraft eine Realität diktieren konnte, die uns und nur uns genehm ist, ganz nach unseren Bedürfnissen und Interessen.“
Und in seiner Momentaufnahme der Protestbewegung gegen Netanjahus geplante Justizreform räumt er dann mit der angeblichen Einheit der israelischen Gesellschaft auf; der Bildung einer solchen stehe vor allem der verheerende Einfluss der Religion auf die Politik im Wege oder der weiter ungelöste Status der israelischen Araber. Der Protest, dem sich Menschen mit verschiedensten Berufsbiografien anschließen und der Schikanen und rechten Delegitimierungs-Kampagnen ausgesetzt ist, offenbare aber auch alte und neue Identitätsschichten von Israelis.
Am schärfsten fällt Grossmans Israel-Kritik dort aus, wo er die Berechtigung Israels, „sich als Demokratie zu definieren“, aufgrund seiner „Besatzungsherrschaft“ seit dem Sechstagekrieg infrage stellt und zu einem drastischen Vergleich greift:
„Jahre der Besetzung und Unterwerfung drohen im Besatzer das Gefühl auszulösen, der Wert des Menschen ließe sich nach einer Stufenleiter bemessen. Die Eroberten werden irgendwann als von Natur aus minderwertig eingeschätzt, als minderwertig geschaffen. Die Erniedrigung entspricht offenbar ihrem Wesen, man darf sie getrost ihrer natürlichen Menschenrechte berauben, ihre Werte und Wünsche verspotten – nicht anders sahen und sehen Antisemiten die Juden. Die Eroberer halten sich dann bald für überlegene, zur Herrschaft geborene Geschöpfe. Wächst in einer solchen Wirklichkeit der Einfluss der Religion, dann erstarkt der Glaube, das alles geschähe nach göttlichem Willen. Kein Wunder also, dass in einem solchen Bewusstseinsklima die demokratische, tolerante, liberale Weltanschauung sich auf dem Rückzug befindet.“
Grossmans Versöhnungsutopie sieht mehrere Maßnahmen vor: Trotz ihrer schmerzlichen Geschichte als Minderheit müssten Jüdinnen und Juden lernen, „die Mehrheit zu sein“ und den Verpflichtungen gegenüber Minderheiten, wie der arabischen, nachzukommen. Der Staat Israel müsste sein „hermetisches, die Realität effektiv ausblendendes Selbstbild nebst dazugehörigem Narrativ“ zugunsten eines neuen aufgeben, indem es etwa die Lehrpläne im Schulwesen revidiere. Es geht Grossman, mit anderen Worten, auch um eine neue Erinnerungskultur, bei der man „die prägende Geschichte seiner Gemeinschaft“ pflege, „ohne die prägenden Geschichten anderer zu beeinträchtigen“. Das ist nichts anderes als das, was der amerikanische Anglist Michael Rothberg unter dem Begriff einer „multidirektionalen Erinnerung“ fasst.
Mit dem 7. Oktober 2023 und dem Terror der Hamas gegen Israel verlagert sich schließlich auch der thematische Fokus von David Grossman. Trotz seiner pazifistischen Haltung legt er beinahe jegliche Hoffnung auf die baldige Beilegung des Konflikts ab. Dennoch entwirft er ein Nachkriegsszenario und sieht darin eine noch rechtere, militantere und rassistischere israelische Regierung aufkommen. Doch an der Verantwortung für den Terror lässt er keinen Zweifel aufkommen.
„Die Gräueltaten dieser Tage sind nicht Israel zu zuschreiben. Sie gehen aufs Konto der Hamas. Wohl ist die Besatzung ein Verbrechen, aber Hunderte von Zivilisten zu überwältigen, Kinder, Eltern, Alte und Kranke, und dann von einem zum anderen zu gehen und sie kaltblütig zu erschießen – das ist ein viel schwereres Verbrechen.“
Am Ende ist es die Literatur, die ihm Trost und Zuversicht bietet. In den Tagebüchern der in Auschwitz ermordeten Intellektuellen Etty Hillesum findet David Grossman, schon für eine Dankesrede im Jahr 2022, die Wendung vom „denkenden Herzen“, also einem einfühlsamen, seine Humanität nicht aufgebenden Verstand, der hilft, selbst in untragbaren Verhältnissen ein freier Mensch zu bleiben.
Das schmale Buch von David Grossman ist eine beklemmende Lektüre, unsentimental und doch berührend geschrieben, nie belehrend. Er gehört zu den wenigen, die sich, trotz methodischer Risiken, noch inmitten von Trauerarbeit der Auseinandersetzung mit den Ursachen stellen.
Der Text wurde erstmals am 29.1.2024 im DLF-Büchermarkt gesendet.
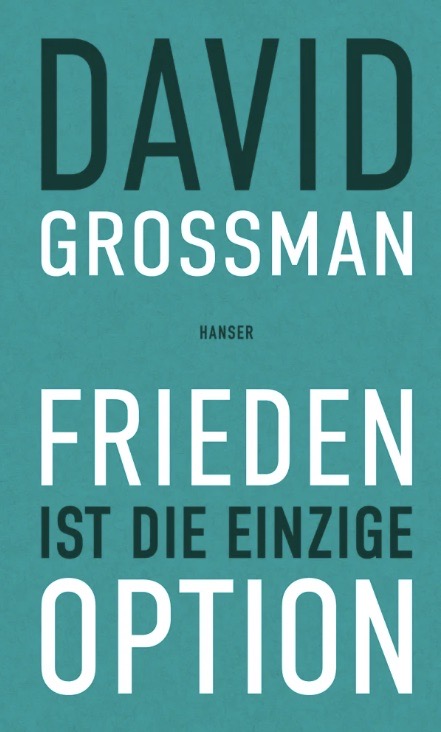
David Grossman
Frieden ist die einzige Option
übersetzt aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, Helene Seidler,
64 S., geb.
ISBN: 978-3-446-28156-1
Carl Hanser Verlag, München 2024,
Erstellungsdatum: 21.12.2024