


 MENU
MENU

Flüsse sind lebendig, sind Mütter, Geliebte, Antwortende. Wolfgang Borchert führt das in seinem zunächst als Hörspiel gedachten Werk „Draußen vor der Tür“ vor Augen. Hier lässt er die Elbe mit dem geschundenen Kriegsheimkehrer sprechen, der dies als tröstliche Begegnung erfährt. Matthias Buth zeigt den Stellenwert, den die humanitäre Kraft der Vorstellung bei Borchert besitzt und – dass sie versöhnen kann. Er kommt zu dem Schluss: Im dissonanten Deutschland der Gegenwart brauchen wir mehr Borchert.
Noch spiegeln die Scheiben, denn der Morgen ist noch eingeschwärzt, als die Bahn ausfährt aus dem Bahnhof Hammerstein und in die Häuserschlucht eintaucht. In Sonnborn blinzelt Licht aus den Küchen, sie schweigen vorbei. Am Stadion dann der kühne Schwebeschwung nach links und 15 Meter tiefer die Wupper, die Bandweberin durchs Tal bis Barmen, die immer singend spricht, immer liebt und abweist. Denn alle Flüsse sind Geliebte. Und Wuppertal ist eine schwarze Harfe. Sie wird gespielt durch den Fluss.

Else Lasker-Schüler ging noch weiter, sie verwandelte sich geradezu zur Wupper, horchte die Sprache ab, von sich und der vielen Personen, die sie im Fünfakter „Die Wupper“ von 1909 auftreten lässt, oft in Elberfelder Quer-Deutsch, das ihr so flott über Mund und Feder ging. Sie lässt sie den Fluss nicht personifiziert sprechen, aber viele im Stück sprechen so, wupperbunt und -wund, dass sie quasi der Fluss selbst sind – der Weber, Färber und Schmiede: Ob Mutter Pius, Amanda oder Willem, der Zuhälter, der mal Weber war, ob auf dem Jahrmarkt oder im Arbeiterviertel. Nur eine Zeile hebt daraus heraus: „Durch den Garten wollen wir wieder wandeln, Mutter, weltentrückt, wie durch einen duftenden Psalm.“ Idylle wird beschworen in diesem atmenden Vers, in einer Zeile, die wie Weyrauch duftet. Der Psalm wird zum Garten, zur Gegenwelt, die Heimat gegeben kann – weitab der Wupper.
Wer schon als Schüler jeden Morgen den Blick ins Wasser heftet, in die flachen Wellen der Wupper, trägt den Code dieses schwarzen Bandes in sich, streift auch in anderen Regionen der Welt die Ufer ab und meint, in den Flüssen eine eigene Sprache zu sehen und zu hören: das Endlosband des Selbstgesprächs, das gegen alle Widerstände darauf hofft, ein Gegenüber zu finden.
Flüsse sind Lebende, sind nicht fern, sind Mutter, Geliebte, Antwortende. Wolfgang Borchert entdeckt dies 1947 im Hörspiel „Draußen vor der Tür“. Er lässt die Elbe sprechen, sie spricht mit dem Heimkehrer ohne Heimat, mit Beckmann, dem ehemaligen Unteroffizier, der uns bis zum heutigen Tag ausleuchtet, was Heimatlosigkeit, was das Nichtankommen, bedeuten:
„Der Traum
(In der Elbe. Eintöniges Klatschen kleiner Wellen. Die Elbe. Beckmann.)
Beckmann: Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier?
Elbe: Bei mir.
Beckmann: Bei dir? Und – wer bist du?
Elbe: Wer soll ich denn sein, du Küken, wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst?
Beckmann: Die Elbe?
Elbe: Ja, die. Die Elbe.
Beckmann (staunt): Du bist die Elbe!
Elbe: Ah, reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint? Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar? Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süßduftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Ein anständiger Fluss stinkt. Jawohl. Nach Öl und Fisch. Was willst du hier?
Beckmann: Pennen. Da oben halte ich das nicht mehr aus. Das mache ich nicht mehr mit. Pennen will ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. Zehntausend Nächte pennen.
Elbe: Du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, hm? Da oben, wie? Du bildest dir ein, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger?
Beckmann: Fünfundzwanzig. Und jetzt will ich pennen.
Elbe: Sieh mal, fünfundzwanzig. Und den Rest verpennen. Fünfundzwanzig und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du Greis?
Beckmann: Alles, alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern. Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot – ich kann das nicht mehr, verstehst du!
Elbe: Nein. Du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du! Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt, deswegen kannst du hier bei mir untern Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ersaufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden, kahl und blank. Nee, gibt es nicht, mein Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir strammziehen, Kleiner, jawohl! Auch wenn du sechs Jahre Soldat warst. Alle waren das. Und die hinken alle irgendwo. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen: Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder! Wenn du den Kanal voll hast, hier, bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen vieren angekrochen kommt, dann können wir mal wieder über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Handvoll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie. Ich will sie nicht, du gerade eben Angefangener. Halt den Mund, mein kleiner Menschensohn! Ich will dir was sagen, ganz leise, ins Ohr, du, komm her: ich scheiß auf deinen Selbstmord! Du Säugling. Pass gut auf, was ich mit dir mache, (laut) Hallo, Jungens! Werft diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand! Er will es nochmal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sachte, er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der Lausebengel, der grüne!“
Eine anrührende Inszenierung, flott hingehauen und doch voller Raffinesse die Seelenlage des Lebenserschöpften ausleuchtend. Die slangnahe Sprache hätte der bergischen Dichterin von der Wupper gefallen. Borchert war Theatermann, ein Komödiant und stieg so noch tiefer in seine Traurigkeit hinab. Trost erwartete er eher von Frauen und hier von der Elbe, die ihn mütterlich zurechtstutzte und wieder an Land warf. „Du Säugling“: das war mehr ein Stups ins Leben als ein Schlag in die Magengrube. An den Strand von Blankenese geworfen, vielleicht dort, wo heute das von Studenten und Flaneuren oft besuchte Café Strandperle einlädt, die Schiffe zu beobachten, musste der heimkehrende Unteroffizier Beckmann weiterleben, weiterfragen nach Schuld und Verantwortung und wurde immer wieder zurückgeworfen und abgewiesen, weil er zu spät gekommen war, seine Frau anders vergeben und die Straßen elend und leer. Der existentialistische Zug des Stückes, der Notschrei Beckmanns greift auch heute an die Seele, Borchert als neoexpressionistischen Dichter abzutun, ist geradezu borniert, ja herzlos und dumm. Er spricht uns immer noch aus, nicht nur die Soldaten im Donbass beiderseits der Front. Krieg ist immer. Und Einsamkeit, Verlorenheit erst recht.
In Hamburg kam Borchert 1921 zur Welt. Der Zweite Krieg, den Deutschland im vorherigen Jahrhundert über die Welt brachte, war noch weit. Hamburg war 1945 nicht mehr Hamburg, aber immer noch Deutschland, vor allem für jene, die für Deutschland in den Krieg gezogen, die in die Fronten Europas geschickt worden waren und nach 55 Millionen Toten den Heimweg antraten nach Deutschland. Dieses Wort kommt den heutigen Hamburgern kaum noch über die Lippen. Was ist das für ein Land, das für die Menschen steht, die damit Herkunft und Zugehörigkeit bezeichnet bekommen. Es gibt kein Entrinnen. Das Land ist auf der Landkarte geblieben, bleibt ein Sprachland. In das will Beckmann zurück. Und Beckmann sind viele, auch heute, wenn auch ohne Gasmaske und Uniform.
Dem zunächst als Hörspiel konzipierten „Draußen vor der Tür“ gab Borchert den Untertitel „Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will“.
Sein Vorspruch oder Prolog, der nicht zum Sprechtext der Akteure des Stückes gehört, gibt die Melodie vor, die dann die fünf Akte bestimmt:
„Ein Mann kommt nach Deutschland.
Er war lange weg, der Mann. Sehr lange. Vielleicht zu lange. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging. Äußerlich ist er ein naher Verwandter jener Gebilde, die auf den Feldern stehen, um die Vögel (und abends manchmal auch die Menschen) zu erschrecken. Innerlich – auch. Er hat tausend Tage draußen in der Kälte gewartet. Und als Eintrittsgeld musste er mit seiner Kniescheibe bezahlen. Und nachdem er nun tausend Nächte draußen in der Kälte gewartet hat, kommt er endlich doch noch nach Hause.
Ein Mann kommt nach Deutschland.
Und da erlebt er einen ganz tollen Film. Er muss sich während der Vorstellung mehrmals in den Arm kneifen, denn er weiß nicht, ob er wacht oder träumt. Aber dann sieht er, dass es rechts und links neben ihm noch mehr Leute gibt, die alle dasselbe erleben. Und er denkt, dass es dann doch wohl die Wahrheit sein muss. Ja, und als er dann am Schluss mit leerem Magen und kalten Füßen wieder auf der Straße steht, merkt er, dass es eigentlich nur ein ganz alltäglicher Film war, ein ganz alltäglicher Film. Von einem Mann, der nach Deutschland kommt, einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil für sie kein Zuhause mehr da ist. Und ihr Zuhause ist dann draußen vor der Tür. Ihr Deutschland ist draußen, nachts im Regen, auf der Straße.
Das ist ihr Deutschland.“
Wie lesen heute Schüler diesen Text, wie eine Frau oder Mann aus der Ukraine, Syrien oder Afghanistan, wie jemand, der es nicht schafft, hier heimisch zu werden als Flüchtling aus dem Osten oder auch als langansässiger Staatsbürger, der keine Bindung mehr findet, sich ausgegrenzt und vereinsamt fühlt? Nachkrieg oder schon Vorkrieg? Kriegstauglich will keine und keiner werden. Und doch spüren wir den Abendhauch der noch nicht abgeschossenen Raketen. Wir sind alle draußen. Es gibt kein Drinnen mehr.
Die Schlussszene des Dramas, eigentlich ein großes Gedicht, ein Selbstgespräch de profundis, endet so wie der Prolog und reicht uns einen existentiellen Schrei, fast ein Testament hinüber in unsere Gegenwart:
„Ein Mann kommt nach Deutschland! Und dann kommt der Einbeinige – teck – tock – teck – kommt er, teck – tock, und der Einbeinige sagt: Beckmann. Sagt immerzu: Beckmann. Er atmet Beckmann, er schnarcht Beckmann, er stöhnt Beckmann, er schreit, er flucht, er betet Beckmann. Und er geht durch das Leben seines Mörders teck – tock – teck – tock! Und der Mörder bin ich. Ich? der Gemordete, ich, den sie gemordet haben, ich bin der Mörder? Wer schützt uns davor, daß wir nicht Mörder werden? Wir werden jeden Tag ermordet, und jeden Tag begehn wir einen Mord! Wir gehen jeden Tag an einem Mord vorbei! Und der Mörder Beckmann hält das nicht mehr aus, gemordet zu werden und Mörder zu sein. Und er schreit der Welt ins Gesicht: Ich sterbe! Und dann liegt er irgendwo auf der Straße, der Mann, der nach Deutschland kam, und stirbt. Früher lagen Zigarettenstummel, Apfelsinenschalen und Papier auf der Straße, heute sind es Menschen, das sagt weiter nichts. Und dann kommt ein Straßenfeger, ein deutscher Straßenfeger, in Uniform und mit roten Streifen, von der Firma Abfall und Verwesung, und findet den gemordeten Mörder Beckmann. Verhungert, erfroren, liegengeblieben. Im zwanzigsten Jahrhundert. Im fünften Jahrzehnt. Auf der Straße. In Deutschland. Und die Menschen gehen an dem Tod vorbei, achtlos, resigniert, blasiert, angeekelt, und gleichgültig, gleichgültig, so gleichgültig! Und der Tote fühlt tief in seinen Traum hinein, daß sein Tod gleich war wie sein Leben: sinnlos, unbedeutend, grau. Und du – du sagst, ich soll leben! Wozu? Für wen? Für was? Hab ich kein Recht auf meinen Tod? Hab ich kein Recht auf meinen Selbstmord? Soll ich mich weiter morden lassen und weiter morden? Wohin soll ich denn? Wovon soll ich leben? Mit wem? Für was? Wohin sollen wir denn auf dieser Welt! Verraten sind wir. Furchtbar verraten. Wo bist du, Anderer? Du bist doch sonst immer da!
Wo bist du jetzt, Jasager? Jetzt antworte mir! Jetzt brauche ich dich, Antworter! Wo bist du denn? Du bist ja plötzlich nicht mehr da! Wo bist du, Antworter, wo bist du, der mir den Tod nicht gönnte! Wo ist denn der alte Mann, der sich Gott nennt? Warum redet er denn nicht!!
Gebt doch Antwort!
Warum schweigt ihr denn? Warum?
Gibt denn keiner Antwort?
Gibt keiner Antwort???
Gibt denn keiner, keiner Antwort???“
Nein, keiner, wer gab den im Stahlwerk von Mariupol Eingeschlossenen Antwort, wer den Menschen in den U-Bahnschächten, wer den in Damaskus befreiten Opfern?
Borchert fragt in seinem Opus Magnum nicht nach der strafrechtlichen Verantwortung von Wehrmachtssoldaten, nicht nach Befehl und Gehorsam und den Grenzen, die sich im bis 1945 geltenden Militärstrafgesetzbuch, dort in § 47 MStG statuierten. Er greift tiefer, lässt ungeschützt in seine seelische Not der Antwortlosigkeit blicken, ohne rechtliche Grenzen. Siegried Lenz machte es anders in seiner Novelle „Ein Kriegsende“ im Jahre 1984 und ging der Frage nach, ob für Marinesoldaten im Angesicht des verlorenen Krieges und dessen nahen Endes Befehle zum Auslaufen der Schiffe noch verbindlich sein konnten und diskutiert die o.a. Rechtsnorm, die auch im Nationalsozialismus nicht abgeschafft worden war und tatsächlich dem Gehorsam der Soldaten Grenzen setzte. Das Berufen auf den sogenannten Befehlsnotstand, auf den sich so viele Wehrmachtssoldaten und die Waffen-SS, für die ab 1941 auch das Militärstrafrecht galt, beriefen, war in der Regel rechtlich irrelevant. Man konnte Befehle eben verweigern, auch wenn die NS-Ideologie und der Eid auf Hitler diese Rechtsnorm überlagerten.
Dem Aufschrei-Drama „Draußen vor der Tür“ benachbart, ja verschwistert ist der parolenhafte Text, der als Manifest weit mehr als ein Dokument gegen den Staat, gegen dessen Anspruch und die Aufforderung zu Gewalt und Krieg verstanden wird. Es ist die Standarte des Pazifismus, der Text „Das gibt es nur eins!“ Er richtet sich an die Welt und im Schluss an alle, die Leben ermöglichen, an die Mütter.
„Du. Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen – sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins: Sag NEIN!“ So beginnt der Aufschreitext.
Dann schreit er 12 Mal anderen zu, dem „Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro“, dem „Besitzer der Fabrik“, dem „Forscher im Laboratorium“, dem „Dichter in deiner Stube“, dem „Arzt am Krankenbett“, dem „Pfarrer auf der Kanzel“, dem „Kapitän auf dem Dampfer“, dem „Pilot auf dem Flugfeld“, dem „Schneider auf deinem Brett“, dem „Richter im Talar“, dem „Mann auf dem Bahnhof“ und dem „Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt“, allen, die ihm einfallen, die seine Seele besiedeln und berühren, dieses donnernde „Sag NEIN!“
Diese Litanei endet, gipfelt mit der Anrufung der Mütter und wird dadurch zu einem flehentlichen Gebet:
„Sagt NEIN! Mütter, sagt NEIN!
Denn wenn ihr nicht NEIN sagt, wenn IHR nicht nein sagt, Mütter, dann:“ – eine Generalpause unterbricht und steigert noch einmal die Deklamation – „all dieses wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht, vielleicht heute nacht schon, vielleicht heute nacht, wenn –– , wenn –– wenn ihr nicht NEIN sagt.“
Undenkbar, dieses alles heute in Moskau zu hören, in China und an anderen Stellen der Welt, auch in beiden Teilen Amerikas. Dieser Text ist wie Paul Celans „Todesfuge“ einer der Grundtexte unserer „europäisch gewachsenen Kulturnation“, wie das Deutsche Welle Gesetz erst 2005 definiert. „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, dichtete Celan, ein Vers, den Borchert nicht kennen konnte (1944 geschrieben, 1947 in rumänischer Fassung und erst 1952 im Band „Mohn und Gedächtnis“ als deutsches Gedicht wahrnehmbar veröffentlicht), der ihm aber aussprach, auch oder obwohl Borchert zum Holocaust, zur Shoa nicht schrieb, weil ihm diese Dimension des Kriegs-Grauens nicht bekannt war, vielleicht auch, weil die Wehrmachtssoldaten den Massen- und Völkermord nicht sahen, zu sehr in ihr Soldatenleben eingeschlossen waren oder eben verdrängte wie fast alle Deutschen. Günter Grass, Heinrich Böll und auch Siegfried Lenz sind Beispiele für viele Nachkriegsautoren – auch in der Gruppe 47 –, die den Holocaust literarisch nicht zum Thema machten, diesen den Opfern überließen, wie eben Paul Celan sowie Ruth Klüger, Nelly Sachs oder Primo Levi.
Wolfgang Borchert lebt weiter in Hamburg und auch nicht. Wird er musealisiert, eingemauert und abgestellt in Stelen und Parks und am Geburtshaus? Seine Gedichte, die komisch traurigen Erzählungen und immer wieder das Schauspiel „Draußen vor der Tür“ sind im Gesamtwerk, vortrefflich ediert von Michel Töteberg und Irmgard Schindler im Rowohlt Verlag (4. Auflage 2022) präsent und doch nicht gegenwärtig.
1981 wurde in Alsterdorf die Neubausiedlung an der Hindenburgstraße Ecke Maienweg nach ihm benannt. Aber wer dort nach dem Dichter fragt, bekommt keine Antwort. Schreib doch was über Borchert, sagte mir ein leitender Beamter aus dem Kultursenat, das können die Bürger dann mal lesen. Im westdeutschen Nachkriegsdeutschland waren das Drama und auch die Erzählungen schon in der Mittelstufe der Gymnasien Kanon. Aber in der DDR nicht, Borcherts Weltsicht brach sich an der SED-Kulturpolitik, die aufs Militärische, auf die Subordination unter die Ideologie des sogenannten Arbeiter- und Bauernstaates setzte und so mehr Dunkel-Deutschland war als ein helles Land. Angela Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren, hat sich aber nie zu Wolfang Borchert geäußert, auch nicht im Buch, das sie 2024 großspurig „Freiheit“ nannte, 700 Seiten Selbsterzählung vom Alles-richtig-Machen, ein Selfie-Buch, aber eben keine Dichtung und schon gar nicht eine Schrift, die wie Borchert fragt, der nach Deutschland fragt. „Ein Mann kommt nach Deutschland“. Was ist das für ein Land? Erfassen können es ohnehin nur Dichter und Dichterinnen, wohl kaum solche Politiker wie Scholz und Merkel, die sich zwar durch das Grundgesetz und so vom deutschen Volk Macht und Gestaltungsauftrag geben lassen, sich aber sonst in der kollektiven Wir-Schwäche gefallen wie auch Bundespräsident Steinmeier in seinem letzten Buch und den Begriffen wie Nation, Volk und Bergpredigt ausweichen.
Stauffenberg hätte Borchert verstanden, denn er und seine Mitverschwörer setzten ihr Leben und Können für Deutschland und für ihre Idee eines Landes der Poesie und Musik ein. Es ging um jenes Land, das nach 55 Millionen Toten auf Europas Landkarte geblieben ist, trotz aller deutschen Verbrechen. Dass es so gekommen ist, verdanken wir der Dichtung, der Musik, den Künsten und somit allen, die an die humanitäre Kraft der Vorstellung und der Klage glauben, eben Menschen wie Borchert. Sie sind Ausdruck eines Deutschlands, das uns ausspricht und auch versöhnen kann.
„Wer schreibt für uns eine neue Harmonielehre? Wir brauchen keine wohltemperierten Klaviere mehr. Wir selbst sind zu viel Dissonanz“, schreibt Borchert im Text „Manifest“. Eben – mehr Borchert brauchen wir: in Hamburg und im ganzen dissonanten Deutschland von 2025. Die Wupper Lasker-Schülers und die Elbe Borchert sprechen mit uns in deutschen Versen und Sätzen so wie die Donau Hölderlins und der Rhein Heines. Flüsse sind wie Geliebte, die bleiben. Sie dichten uns zu.
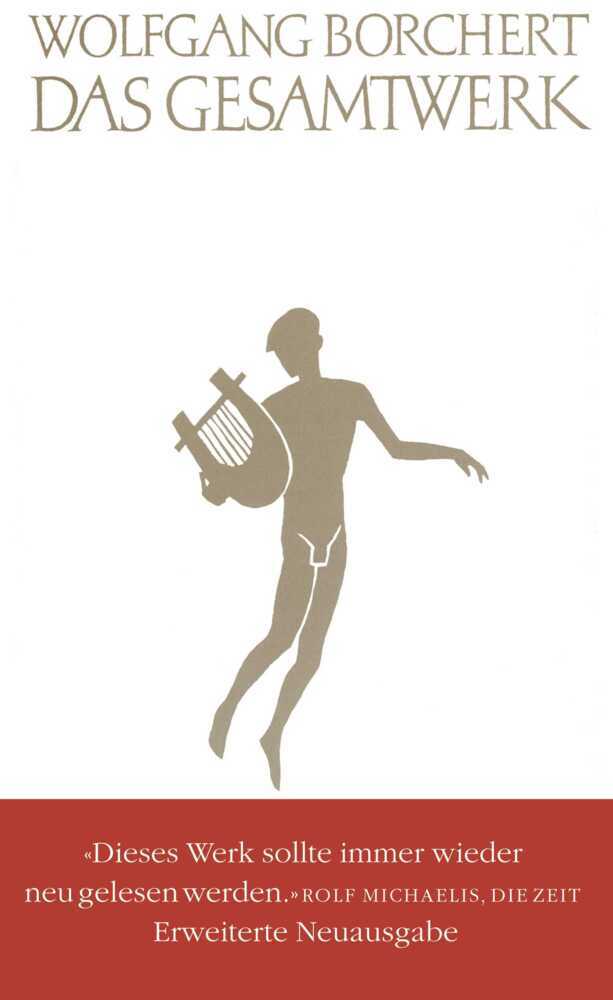
Wolfgang Borchert
Das Gesamtwerk
Hrsg. von Michel Töteberg und Irmgard Schindler
569 S., geb.
ISBN-13: 978-3-498-00652-5
Rowohlt Verlag, Hamburg 2011/4. Aufl. 2022
Bestellen
Erstellungsdatum: 14.01.2025