


 MENU
MENU

„ … Wer bin ich schon?: gefesselt, eingesperrt in die Gegenwart, die Rückwege habe ich mir bewußt selbst zugemauert, keine Vergangenheit mehr.“, schrieb der sensible und reizbare Dichter in „Rom, Blicke“. Muss man ihn sich so vorstellen? Zum 50. Todestag erscheint von Michael Töteberg und Alexandra Vasa die erste Biographie über Rolf Dieter Brinkmann. Wolfgang Rüger hat „Ich gehe in ein anderes Blau“ gelesen.
Vor 50 Jahren ist der letzte Berserker gestorben, der mit drastischer Sprache eine Bestandsaufnahme der bundesrepublikanischen Verhältnisse vorgenommen und mit allem schonungslos abgerechnet hat. Keiner hat so zornig, unbestechlich, kompromisslos und unerbittlich gegen das „Scheißhaus Wirklichkeit“ gewütet, keiner hat sich mit solch unglaublicher Sensibilität den Reizen seiner Umwelt ausgesetzt wie Rolf Dieter Brinkmann (1940-1975).
Aus Anlass seines 85. Geburts- und 50. Todestages veröffentlicht Rowohlt zwei Bücher, die erste Biografie über ihn und die wohl endgültige Fassung seines monolithischen Gedichtbandes „Westwärts 1&2“, die diesen „radikalen Rebellen“ (Heinrich Vormweg) ins Bewusstsein zurückholen. Endlich neue Publikation, ist man fast geneigt zu sagen.
Die Bedeutung bzw. Sprengkraft eines Autors kann man auch an der Zahl der Sekundärliteratur über ihn ablesen. Obwohl in den letzten 20 Jahren so gut wie nichts Neues aus dem Nachlass von Brinkmann erschienen ist, wuchs die Zahl der Publikationen über ihn kontinuierlich. In Roberto Di Bellas monumentalem Buch „… das wild gefleckte Panorama eines anderen Traums“ umfasst allein der Apparat 60 Seiten.
Michael Töteberg hat in den zurückliegenden Jahren hier und da kürzere Essays über Brinkmanns Leben veröffentlicht. Jetzt hat er mit seiner Co-Autorin Alexandra Vasa unter anderem Tausende von Briefen gelesen – solche, die Brinkmann geschrieben, und solche, die er erhalten hat –, die aussagekräftigsten Stellen extrahiert, und daraus auch für Brinkmann-Kenner eine detailreiche und flüssig lesbare Biografie gemacht, die nicht nur Brinkmanns Leben fast minutiös nacherzählt, sondern auch ein lebendiges Porträt des bigotten und prüden westdeutschen Literaturbetriebes der sechziger und siebziger Jahre zeichnet.
Das Buch ist voller wunderbarer Fundstücke. „Gezähmter Mallarmé, verschnittener Trakl, ondulierter Goll. Die üblichen, harmlos-gefälligen Vorstellungsketten, die man in der ästhetischen Provinz als modern empfindet …“, kanzelt z.B. der damalige Lektor Peter Rühmkorf die von Brinkmann Ende der fünfziger Jahre bei Rowohlt eingereichten Gedichte ab.
Brinkmann war ein manischer Briefeschreiber. Briefe, in denen er oft auf über 50 Seiten haarklein seinen Alltag und sein künstlerisches Schaffen referierte, waren keine Seltenheit. Anhand der immensen Zahl der Briefe, die heute in diversen Archiven liegen, können die Biografen aus dem Vollen schöpfen. Sie müssen nichts zusammenreimen, keine Spekulationen anstellen, sie zitieren einfach ausführlich aus den Briefen, in denen Brinkmann selbst über seinen seelischen Zustand in bestimmten Situationen akkurat Auskunft gibt.
Auch seine Kindheit und Jugend sind aus den Briefen authentisch rekonstruierbar. „In den ersten Kriegstagen zusammengefickt … ich bin nur da, weil es einen Krieg gab.“ Frühe Liebschaften, schulische Aktivitäten, erste Schreibversuche – nichts bleibt im Dunkeln. Glücklicherweise haben alle Adressaten offensichtlich nichts weggeworfen. Eine herausragende Bedeutung kommt Ralf-Rainer Rygulla zu, der viele Jahre die wichtigste Bezugsperson Brinkmanns war, der ihn mit der amerikanischen Beatliteratur bekanntgemacht hat, mit dem zusammen die wegweisenden Anthologien „ACID“ (1969) und „Silverscreen“ (1969) entstanden sind und der seit Jahren einen Verlag sucht für die gemeinsam verfassten Texte „Frank Xerox‘ wüster Traum und andere Kollaborationen“.
Mit Hilfe der Briefe lassen sich wechselnde Freundschaften, private Befindlichkeiten, poetologische Entwicklungen, kulturelle Einschätzungen, politische Überzeugungen, Mechanismen im Netzwerk des Literaturbetriebs einfach nachweisen. Chronologisch verfolgt der Leser, wie Brinkmanns Leben sein Werk beeinflusst, wie er Höhen und Tiefen bewältigt, wie er mit seinen Ambitionen ringt, welche Vorbilder er hat, welche Autoren ihn protegieren, wie er sich nach und nach im Literaturbetrieb etabliert, ohne sich korrumpieren zu lassen. „Ich bin nicht an Methoden interessiert. Ich bin am Experiment meiner Wahrnehmung interessiert. Am Sehen. An meinem Sehen. Und dieses Sehen erschöpft sich ja nicht in seinen physischen Aspekten. Mir geht es nicht darum, etwas anderes zu sehen, sondern es anders zu sehen.“
Unbeantwortet bleibt leider die Frage, wie das emotionale Verhältnis von Maleen Brinkmann zu ihrem Ehemann kurz vor seinem Tod war. Die Ehe war zerrüttet, bestand seit Jahren nur noch aus Streitereien. Brinkmann war überfordert mit der Betreuung des behinderten Sohnes. „Die Familie bietet mir keinen Schutz (wieso auch?)“. Aber lief die Trennung auf einen Rosenkrieg hinaus, gab es von Seiten Maleens Rachegelüste? Das hätte man gerne gewusst.
Das ist insofern bedeutend, weil man dann besser verstehen könnte, warum Maleen Brinkmann zumindest in den ersten zehn Jahren nach Brinkmanns Tod alles getan hat, um Brinkmanns Nachruhm zu verhindern. Bis heute – 50 Jahren nach seinem Tod – ist noch immer nicht alles publiziert, was Brinkmann zu Lebzeiten schon veröffentlichen wollte. Jahrelang kündigte Rowohlt Bücher an, die dann nie erschienen sind. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwierig die Witwe im Umgang war. Meinen Mitte der Achtziger geplanten Materialband zu Brinkmann hat sie zum Beispiel auch mit allen Mitteln verhindert.
Erstaunlich ist, dass der Name Jürgen Ploog kein einziges Mal bei Brinkmann auftaucht. Den deutschen Underground der sechziger Jahre kann man meiner Meinung nach in zwei Gruppierungen aufteilen: auf der einen Seiten die Kölner, deren Kopf Brinkmann war, auf der anderen Seite die Frankfurter, die von Ploog angeführt wurden. Warum gab es zwischen diesen fast gleichaltrigen Brüdern im Geiste, die zur gleichen Zeit die gleichen Ziele verfolgten und mit dem Melzer Verlag einen gemeinsamen Berührungspunkt hatten, keinen Austausch? Ihre Ähnlichkeit reicht bis zum kreativen Chaos, das in ihren Arbeitszimmern herrschte. Das von Brinkmann ist in dem Fotoband „Engelbertstraße 65, vierter Stock, Köln 1969“ von Ulrike Pfeiffer wunderbar dokumentiert.
Im Werk von Ploog taucht der Name Brinkmann ständig auf. Ich vermute, Brinkmann hat Ploog gerade deshalb ignoriert, weil sie sich literarisch so nahe waren. Die Autoren, die er gelten ließ, waren alle tot: Jahnn, Benn, Tieck, Moritz. Sie konnten ihm nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Mit den zeitgenössischen Autoren, mit denen er persönlich zu tun hatte (u.a. Born, Chotjewitz, Wellershoff, Piwitt), lag er im Dauerclinch. Wüste Beschimpfungen waren an der Tagesordnung.
Sehr eindrücklich die Schilderungen seiner Exzesse bei Lesungen von Kollegen, bei Verlagsfesten oder gegenüber den Angestellten in der Uniadministration in Austin. Viele hatten regelrecht Angst vor ihm. Brinkmanns Streitlust, sein „tobsüchtiges Sprechen“ (Born), seine Hasstiraden, seine Wutausbrüche ziehen sich durch das ganze Buch. Dieter Wellershoff, sein wahrscheinlich wichtigster Lektor und Förderer, erzählt: „Er konnte liebenswürdig, intuitiv und anregend sein und eine Atmosphäre von freundschaftlicher Gemeinsamkeit verbreiten und wenige Zeit danach scheinbar grundlos in besinnungslose Aggression verfallen.“
Worüber bis heute gesprochen wird, war 1968 der Eklat während einer Veranstaltung in der West-Berliner Akademie der Künste. In der Biografie kann man nachlesen, was damals passiert ist und worüber sich Reich-Ranicki noch Jahrzehnte später erregte: „Ich kann mich an Brinkmann sehr gut erinnern. Das war ein ungewöhnlich ordinärer und abstoßender Mensch, er hat in aller Öffentlichkeit und sehr ernst erklärt, dass er das dringende Bedürfnis habe, mich zu erschiessen.“
Brinkmann hat sich bewusst aus dem Literaturbetrieb herauskatapultiert, er gefiel sich in der Rolle des Outcasts. Im Gegensatz zu Ploog, der alle amerikanischen Heroen persönlich getroffen und gekannt hatte (Burroughs, Gysin, Ginsberg, Pelieu, Beach etc.), stand Brinkmann mit keinem einzigen dieser Zeitgenossen in persönlichem Kontakt, hat ihn auch nicht gesucht.
Er war auf der Suche nach etwas Neuem in der Literatur, wollte die Verkrustungen aufreißen und konnte doch nicht aus seiner Haut. Selbst als Stipendiat in der Villa Massimo war er ein „Norddeutscher in Arkadien“, der „von Grünkohl, Pinkelwurst, Schweinerippchen und Salzkartoffeln, vorher eine Sternchennudelsuppe, nachher einen Steinhäger“ träumte. Sein Naturell war der kritische Blick, in Rom gab es praktisch nichts, was ihm gefiel. Die Mitstipendiaten wähnten sich im Paradies, Brinkmann rotzte seine Wut aufs Papier. Dabei herausgekommen sind die posthum veröffentlichten Materialbände „Rom, Blicke“ (1979), „Erkundungen …“ (1987) und „Schnitte“ (1988), die ihn endgültig zum Kultautor machten.
Der Gedichtband „Westwärts 1&2“ (1975) war das letzte Manuskript, das er vor seinem Tod noch selbst als Buch konzipierte, dessen Erscheinen er aber nicht mehr erlebte. Aus Kostengründen musste er schmerzliche Kürzungen vornehmen. Jetzt ist der Band mit 26 neu aufgenommenen Gedichten und allen Vor- und Nachworten parallel zur Biografie erschienen und unterstreicht nachdrücklich „seinen Rang als ersten deutschen Lyrik-Neuerer nach Benn und Celan“ (Klaus Theweleit). Mit „Westwärts 1&2“ erschloss er Neuland, formal wie inhaltlich, die Gedichte sollten einfach sein wie Songs, uferten aber größtenteils zu seitenlangen Rhizomen aus. In „Fragment, 3“ zum Beispiel presst er fast sein ganzes Leben in Strophen, handelt im Stakkato den Tod seines Vaters und seiner Mutter ab und sucht gleichzeitig nach endgültigen Antworten: „Was habe ich nach einer Woche/ Leben gespürt?“
In einem Telefonat mit dem Verlag brachte er sein Vorhaben auf einen Nenner: „Es ist ein subjektives Buch, ohne Rücksicht auf die herrschenden literarischen Konventionen, und kann ebenso gut als ein zusammenhängendes Prosabuch, Gedichtbuch wie Essaybuch gelesen werden.“
Brinkmann lebte ein Leben „ohne Rücksicht auf Verluste“ (Jürgen Ploog), immer hart am Existenzminimum. Kontoüberziehung, Schulden, Sozialhilfe und Besuch vom Gerichtsvollzieher waren für ihn nichts Ungewöhnliches. Kurz vor seinem Tod zogen dann sogar noch Ehefrau und Kind aus der gemeinsamen Wohnung. Da ist es fast ein Hohn des Schicksals, dass ihn der Außenspiegel eines Lieferwagens am 23. April 1975 aus dem Leben riss, weil er beim Überqueren einer Straße in London auf dem Weg zu einer Kneipe den Linksverkehr missachtete.
„Ein Frühvollendeter der Gegenwart“ (Heinrich Vormweg), der in den Sechzigern „mit der Axt in der Hand ins rosarote Biedermeier gefahren“ war (Uwe Schweikert), verschwand von der deutschen Literaturbühne und hinterließ eine große Leere. Weit und breit keiner, der in Brinkmanns Fußstapfen treten konnte, der mit dem gleichen Furor die aktuelle Lage des Planeten zum Thema machte.
Wir leben in trostloser Zeit. Wer im aktuellen Literaturbetrieb findet dafür die angemessenen Worte. Wo sind die Autoren, die ein Lebensgefühl auf den Punkt bringen können, die eine Rebellion entfachen gegen die Verkommenheit des politischen Establishments, die eine Utopie entwerfen für eine bessere Zukunft.
Gerade jetzt, wo die Welt nach rechts rückt, wäre Aufstand dringend geboten. Wo sind die jungen Autoren mit ihren Gegenentwürfen. „Wie steril, blaß, leblos, entsinnlicht, unlebendig das ist – wie Anbau-Möbel, Prosa nach Schnittmusterbogen gefertigt, Erfahrungen, die so klein sind, ein Lebenshorizont, der nur noch dumpf und eng ist – auch die herzlose Art der Fertigung, das Verschwinden eines Selbstbewußtseins – was laufen denn überhaupt für Figuren in den Büchern herum?“, schrieb Brinkmann 1972, als er allein an Weihnachten in der Casa Baldi hockte und wieder mal eine Bestandsaufnahme machte. Das liest sich, als hätte sich seit damals absolut nichts verändert.
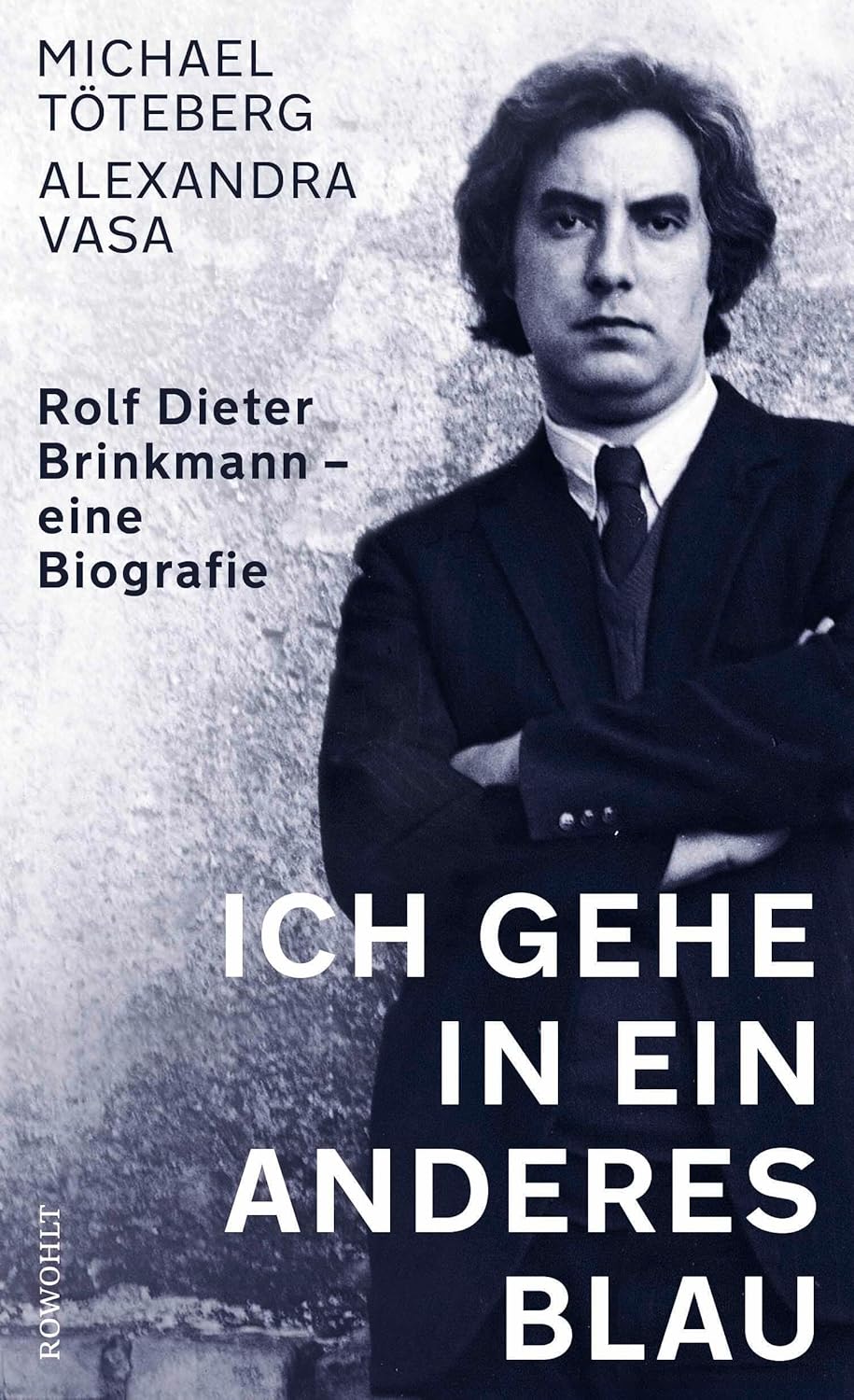
Michael Töteberg,
Alexandra Vasa
Ich gehe in ein anderes Blau
Rolf Dieter Brinkmann – eine Biografie
400 S., brosch.
ISBN: 978-3-498-00392-0
Rowohlt Buchverlag, Hamburg 2025
Bestellen
Erstellungsdatum: 10.03.2025