


 MENU
MENU

Was denkt der Freund? Was denkt der Feind? Der Krieg verhindert alle Kenntnis, nicht nur, weil alle Beteiligten und Parteilichen der eigenen Propaganda aufsitzen, sondern, weil die Kriegsgegner journalistische Recherche mit allen Mitteln verhindern. Wenn dann über einige Umwege ein Buch wie das von Abu Srour, das im Gefängnis geschrieben wurde, den Weg in die Öffentlichkeit findet, löst sich alle Parteinahme auf. Täter und Opfer, Lüge und Verrat. Jutta Roitsch berichtet, was in diesem Buch steht.
Auf der Buchmesse in Frankfurt wusste der französische Verlag Gallimard noch nicht, dass sein Autor Nasser Abu Srour nach 32 Jahren in israelischer Haft freigelassen und nach Ägypten abgeschoben worden war. Inzwischen bestätigte die ägyptische Nachrichtenagentur Mena, dass sich der 56jährige Abu Srour zusammen mit 154 Palästinensern seit dem 15. Oktober in einem streng bewachten Hotel in Kairo aufhält. Ein kurzes Video im Netz zeigt ihn umringt von seinen Geschwistern: ein schmaler Mann mit Bart, zu erkennen an den dicht geschwungenen Augenbrauen. Wer ist dieser Mann, der im Januar 1993 wegen angeblicher Komplizenschaft an einem Mord an einem Israeli zu lebenslanger Haft verurteilt worden war und der in der Haft ein Buch geschrieben hat, das auf verschlungenen Wegen einen arabischen Verlag erreichte, dann vor einem Jahr bei Penguin auf Englisch als „Die Geschichte einer Mauer“ und im Frühjahr dieses Jahres bei Gallimard unter dem philosophisch-verschlüsselten Titel „Je suis ma liberté“ erschienen ist?
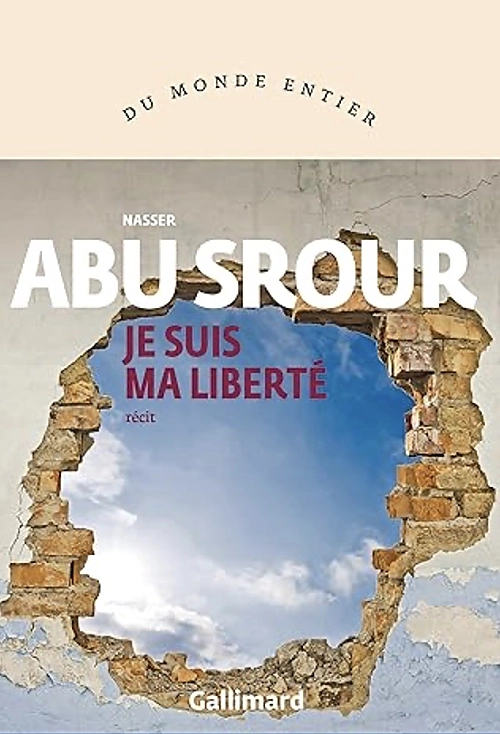
Das Buch taucht tief ein in die Geschichte eines nahezu hundertjährigen Konflikts, der nach dem brutalen Massaker der Hamas am 7. Oktober in Israel und dem fast zweijährigen Vergeltungskrieg unlösbarer denn je erscheint. Welche Geschichte wird in diesem Buch erzählt und welche Rolle spielt sie in den durch den 20- Punkte-Plan des US-Präsidenten zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas ausgehandelten Freilassungen? Es sind zunächst nur Zahlen, die aber schon die Abgründe dieses Konflikts erahnen lassen: Für die 48 noch lebenden oder toten israelischen Geiseln, die die Hamas und islamischen Milizen nach dem Terror am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten, sollte Israel nach der ersten Stufe des „Deals“ des amerikanischen Präsidenten 2000 Palästinenser aus israelischer Haft entlassen. 1700 kehrten in diesen Tagen nach Gaza oder in das von Israel besetzte Westjordanland zurück, die meisten von ihnen, darunter auch Minderjährige, waren nach dem Einmarsch der Israelis als „illegale Kämpfer“ ohne Anklage und Prozess seit zwei Jahren inhaftiert.
Bis zur letzten Minute verhandelte die israelische Regierung über eine von der Hamas vorgelegte Liste mit 250 Namen: Es sind die „Lebenslänglichen“ wie Nasser Abu Srour, die in der palästinensischen Gesellschaft jenseits von den sonstigen Machtkämpfen, ideologischen wie politischen Spaltungen zu einer politischen Elite gehören, auf der Mythen und Träume eines einheitlichen palästinensischen Volkes abgeladen worden sind. Auf diesen „Helden“ oder „Märtyrern“ (so der „Club der palästinensischen Gefangenen“) in israelischen Gefängnissen ruhten und ruhen die Hoffnungen der Palästinenser auf einen eigenen Staat: Zu ihnen gehören „Veteranen“ des bewaffneten Kampfes gegen Israel wie Samir Abu Naama, in Haft seit 1986, oder Mohammed Daoud (verurteilt 1987), aber auch Naim Moussa, einer der Begründer der Al-Aqsa-Brigaden, die zum bewaffneten Arm der Fatah gehörten. Alle ihre Namen standen auf der Liste: 157 der Fatah, 65 der Hamas, 16 des islamischen Dschihad, 11 der marxistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und einer der von der Volksfront abgespaltenen revolutionären Demokratischen Volksfront.
Die israelische Regierung entließ sie ins Exil: Sie dürfen weder Israel noch Ost-Jerusalem noch die seit 1967 von Israel besetzte Westbank oder den Gazastreifen betreten (Le Monde vom 11. und 15. Oktober). Die Länder, die ihnen Exil gewähren wollen: Tunesien, Algerien, Türkei.
Entgegen allen palästinensischen und internationalen Hoffnungen wie Bemühungen findet sich ein Name nicht (mehr) auf der Liste: Marwan Barghouti (66), der prominenteste und populärste unter den Lebenslangen, seit 23 Jahren in strengster Isolationshaft. Und seit dem Massaker der Hamas ohne Kontakt zu Anwälten oder Familie. Er gehört zu der winzigen Gruppe von palästinensischen Führungspersönlichkeiten, die Glaubwürdigkeit genießen und über alle Fraktionen hinweg als verhandlungsfähig für eine Zwei-Staaten-Regelung gelten: Für einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967, für eine Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, für seit Jahren verschleppte freie Wahlen und einen personellen Neuanfang in den Institutionen von der Autonomiebehörde in Ramallah bis zur Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO). Der derzeitigen israelischen Regierung, die einen palästinensischen Staat wie eine Teilung des Landes „from the river to the sea“ ablehnt und mit immer mehr illegalen Siedlungen jüdisches Recht ausweitet, gilt er als der gefährlichste politische Gegner. Je stärker der weltweite Druck wird, Marwan Barghouti freizulassen, um so brutaler wird im Gefängnis Megiddo gegen ihn vorgegangen, berichteten Barghoutis Sohn Arab (Le Monde vom 22. März 2024) und der französische Historiker Vincent Lemire, einer der kundigsten Kenner (Le Monde vom 18. Oktober 2025) des Nahen Ostens.
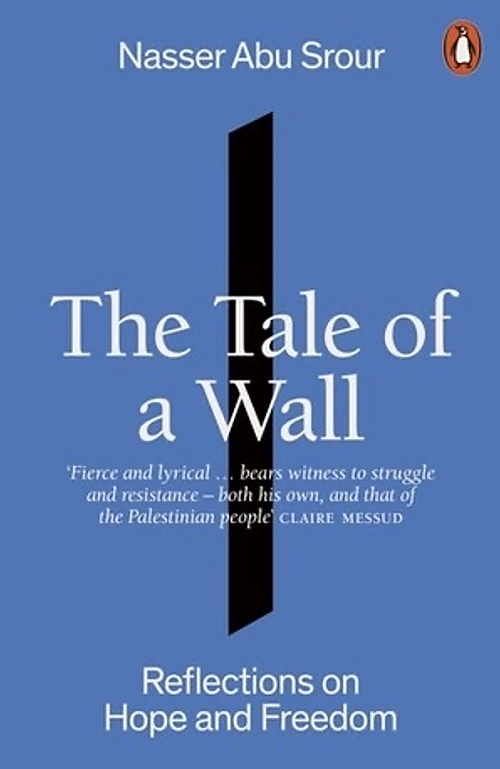
Und in diese von Erwartungen wie Hoffnungen, von Verhärtungen wie Verweigerungen aufgewühlten Zeit fällt die Freilassung von Nasser Abu Srour und seine eindrückliche wie ernüchternde Erzählung von der Mauer, die ihn 32 Jahre lang in einer neun Quadratmeter großen Zelle umgeben hat: In den wechselnden israelischen Gefängnissen in der Wüste, im Westjordanland oder in der Nähe von Aschkelon. An diese Mauer, in die er „Adieu Welt“ kratzt, lehnt er sich an, ihr Beton und Stahl gibt ihm Halt. In den Jahrzehnten bemüht sich Abu Srour, sich und das, was er Freiheit (und Stolz) nennt, nicht zu verlieren. Es ist eine sehr persönliche Erzählung, im zweiten Teil schmerzliche Liebesgeschichte zu seiner jungen Anwältin. Und gleichzeitig gibt Abu Srour, der in der Haft einen Bachelor in Politikwissenschaft machte und Englisch lernte, einen bisher weitgehend unbekannten Einblick in die palästinensische Geschichte der letzten Jahrzehnte: Es ist die Geschichte eines Mannes, der mit Siebzehn begann, aus dem von Mauern umgebenen Flüchtlingslager in der Nähe von Bethlehem auszubrechen und sich die Welt jenseits des Camps anzusehen.
Er begann gegen die resignierte Tatenlosigkeit der Väter zu rebellieren, die nach der Vertreibung aus ihrem bisherigen dörflichen Leben (gemeint ist die mit der israelischen Staatsgründung verbundene Nakba 1948) versucht hätten, ihre Männlichkeit durch das Zeugen von Kindern zu bewahren. Abu Srour, das fünfte von acht Kindern, begann zu lesen und von der Freiheit der palästinensischen Nation zu träumen. Er gehörte zu der revolutionär-nationalistischen Generation der gewalttätigen Rebellion gegen die israelische Besatzung (die erste Intifada, 1987 bis 1993), die eine Befreiung Palästina nach dem Vorbild von Algerien zum Ziel hatte und im Westjordanland wie im Gazastreifen mit Steinen und Waffen Terror verbreiteten. Ob er an der Ermordung des israelischen Geheimdienstmannes direkt beteiligt war, die zu seiner lebenslangen Verurteilung geführt hatte, bleibt unklar trotz der ausführlichen Schilderung der damaligen Vernehmungen: Seine Mauer des Schweigens.
Das Geschichtsbild des Abu Srour bleibt eng: Der jüdische Staat, den er nicht ein einziges Mal beim Namen nennt, ist für ihn „der Okkupant“, mit der jüdischen Geschichte setzt er sich in den Jahrzehnten der Haft nicht auseinander: Weder mit der Vernichtung des europäischen Judentums im Nationalsozialismus noch mit der Vertreibung der knapp eine Million Juden aus den arabischen Staaten von Marokko bis Iran nach der Staatsgründung Israels und der folgenden Kriege. Ihn beherrscht die palästinensische Frage, die Mythen und die Lügen, wie er schreibt. Er erzählt mit Bitterkeit von den Träumen der vertriebenen Eltern und Großeltern, die an die UN-Resolution von 1949 und ihr darin festgeschriebenes Recht auf Rückkehr in die einstigen Dörfer oder Stadtviertel in Jaffa oder Haifa glaubten, obwohl die Dörfer und ehemaligen Stadtviertel nicht mehr existierten.
Dieses Buch, das sich Abu Srour, wie von Seite zu Seite spürbar ist, abgerungen hat, gibt einen bisher kaum bekannten Einblick in die Auseinandersetzungen zwischen den Generationen und in den bewaffneten palästinensischen Kampf, in die erste und zweite Intifada (2000 bis 2005). Die Generation des Abu Srour erlag tatsächlich den Propagandatönen der damaligen PLO-Vertreter, die offiziell Israel als Staat anerkannten, aber inoffiziell den bewaffneten Kampf weiter pflegten: Sie glaubte fest, die internationalen Verhandlungen in Madrid oder Oslo würden den jüdischen Staat Israel beseitigen, den Palästinensern zu ihrem Rückkehrrecht und eigenen Staat verhelfen.
Wie konnten die Jassir Arafats der damaligen Zeit der rebellischen jungen Generation ein solches Weltbild vermitteln, in das sich ab 1987 immer stärker die islamistische Hamas mit ihrer Vision eines muslimischen „Heiligen Krieges“, eines Dschihad, einmischte? Wer war an diesen Illusionen beteiligt und welche Rolle spielte die Lehrerschaft in den Lager-Schulen, die zum großen Teil von der UN-Organisation UNRWA betrieben wurden, die sich seit 1949 alle drei Jahre ein neues Mandat verschaffte, für „Relief and Work“ der Palästinenser in den Lagern zuständig zu sein? Es sind viele Fragen, die sich durch das Buch von Abu Srour neu stellen und die von Historikern zu beantworten wären, so die Archive der UNRWA und der PLO zugänglich wären. Viele Konjunktive.

Nasser Abu Srour selbst verfolgte aus dem Gefängnis heraus die Verhandlungen, die Verzögerungen, letztlich das Scheitern des damaligen Friedensprozesses. Wie genau die Informationen in der Haft möglich waren, erfährt man nicht: Fassungslos schreibt er über die Lügen des „Geschichtenerzählers Arafat“. Welche Lügen er genau meint, bleibt unklar wie sein nationalistisches, klar vom Islamismus der Hamas abgegrenztes Weltbild. Erschüttert wird es zehn Jahre später mit der zweiten Intifada (2000 bis 2005) und politischen Führern wie Marwan Barghouti, den der Autor allerdings nicht namentlich nennt. In den israelischen Gefängnissen, in denen sich nach der Schilderung Abu Srours die palästinensischen Gefangenen nach den Fraktionen in der PLO strikt voneinander abgrenzen („jeder hat seine Ecke“) und nicht miteinander reden, nimmt er mit völligem Unverständnis den Realismus einer neuen Generation wahr, die auf den bewaffneten Widerstand verzichten und mit Israel (und den USA und den UN) eine Zwei-Staaten-Lösung auf dem Territorium des einstigen britischen Palästina-Mandats aushandeln will. Es ist eine der irritierenden Passagen in dem Buch. Er schreibt (S.152): „In Palästina tauchte nach der Ermordung Jassir Arafats eine alte marginalisierte politische Elite wieder auf“. Die Elite habe einen neuen Weg eingeschlagen und den bewaffneten Kampf abgelehnt. „Die einzige Option, die sie im Blick hat, sind Verhandlungen und ein pazifistischer Widerstand.“
Mit dieser Generation bricht Abu Srour. Was ihm bleibt, sind enttäuschte Hoffnungen, die er in den „arabischen Frühling“ setzte, den die Militärs in den arabischen Ländern, vor allem Ägyptens, erstickten. Einige Male hofft er, ausgetauscht zu werden, so auch 2011, als Israel die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit teuer bezahlte: Aber nicht Nasser Abu Srour stand auf der Liste, sondern der ideologische und politische Kopf der Hamas, Jahja Sinwar. Er organisierte zwölf Jahre später aus seinem Exil in Katar heraus das Massaker vom 7. Oktober. Ihn und seinen Bruder Mohammed, der einst Gilad Shalit als Geisel entführte, töteten vor einem Jahr israelische Geheimdienstagenten. Die Leichen gibt die israelische Regierung bisher nicht frei, und auch die Hamas behält tote israelische Geiseln als Geiseln. Wie geht es in diesem Konflikt voller Gewalt und Grausamkeiten weiter? Nasser Abu Srour ist frei, aber für welches Leben?
Der Beitrag erschien zuerst in den bruchstücken.
Erstellungsdatum: 12.11.2025