


 MENU
MENU

Die Erinnerung, die uns heimsucht, hat ihre eigene Struktur, drängt uns ihre Wiederholungen auf, ihre großen und kleinen Sensationen und ihre Traurigkeiten. Diese dynamische Gestalt hat die österreichische Lyrikerin Sophia Lunra Schnack für ihr Buch „feuchtes holz“ übernommen, in dem sie mit eigenwilligen, poetischen Bildern Erinnerung und Nachdenken über immaterielles Erbe miteinander verwebt. Damit ist ihr ein großes Sprachkunstwerk gelungen, findet Bernd Leukert.
An einfacher Sprache, überschaubarer Handlung mit ihrem erwartbaren Verlauf ist kein Mangel, betrachtet man die jährliche Produktion unterhaltender Romane. Die Zumutung grenzüberschreitender Literatur aber, die sich jede anspruchsvolle Leserin und jeder anspruchsvolle Leser für ihren geistigen Bedarf ersehnen, ist nur schwer zu finden.
Der Salzburger Otto Müller Verlag, den es schon seit 1937 gibt, hat 2023 „feuchtes holz“ von Sophia Lunra Schnack herausgebracht. Dieses Buch der 1990 geborenen Wienerin trägt auf dem Umschlag die unvermeidliche Gattungsbezeichnung „Roman“ – bis heute hat sich eine differenziertere Kennzeichnung gegen das pauschale Verkaufskriterium nicht Geltung verschaffen können. Es geht darin allerdings um die in der Literatur gerne thematisierte Reise an den Ort der Kindheit, wo das Gehörte, das Gesehene, vor allem aber das Gerochene eine Fülle von Kindheitserinnerungen hervorruft. Diese Erinnerungsauslöser früh empfangener Eindrücke wie das titelgebende feuchte Holz – eine von Schnacks Madeleines – führen zu krumm laufenden, mäandrierenden Denksequenzen, zu Gedankenspielen, Erzählfäden, die durch Einfälle von der Seitenlinie des Gedankenstroms verloren zu gehen drohen, aber energisch wieder aufgenommen werden.
Wer das Buch aufschlägt, wird auf den ersten Blick bemerken, daß es sich wie ein Prosawerk mit vielen eingestreuten Gedichten präsentiert. Als Irrtum erweist sich das beim zweiten und dritten Blick. Der einzige Unterschied zwischen gebundener und ungebundener Form ist, daß die Verse zuweilen Folgen variierter Textteile erlauben, Wortklammern und daß man sie – laut oder leise – entsprechend der Struktur liest, also in einem anderen Tempo, mit kleinen Pausen, die im Nachklang einen anderen Nachvollzug erlauben als die vergleichsweise ungestalteten Prosateile. So lagern sich die sinnlichen Erfahrungen mehr in den lyrischen Passagen an, wohingegen die narrativen Teile an Fahrt aufnehmen. Doch der spezifische Zugriff auf die Sprache, der lyrische Anspruch findet sich in beiden Formen auf die gleiche Weise.
In einem unaufhörlichen inneren Monolog erarbeitet geradezu Sophia Lunra Schnack die Vergangenheit der Urgroßeltern, Großeltern, Eltern. Fragend und erinnernd variiert sie das Grundthema des Buches: die Imitation und Übernahme der Angewohnheiten und Haltungen von den Vorfahren, die Vererbung von Schuld, Unglück und Traumata auf genetischem Weg über Generationen hinweg. Aber nicht eine politische, soziologische Erschließung bringt sie ins Spiel. „feuchtes holz“ ist ein poetisches Werk. Annäherung geschieht durch Verwandlung und Intuition. So versetzt sie ihren Urgroßvater in ihre Schreibsituation:
im vibrieren aufs neue
von schnürlendem regen
seinen dampfenden wolken
rinnt in dich sein sitzen am fenster
mit tippenden fingern
rinnt in dich sein tageloses hören
von weitergegebener
musik
rinnt in dich diese musik des
urgroßvaters
wie jetzt diese langen tage
aus feuchte
Und zwei Strophen weiter, schreibt sie in Bezug auf den Großvater:
immer wieder schießt es in dich
dass du ihn fragen wirst
hinübergehen wirst
durch äste
der kastanie
durch sie weht sein umblättern der zeitung
seine bestimmtheit
seine ungeduld in schon zittriger
stimme die deinen
namen ruft
Die Annäherung an den Urgroßvater, in dessen Leben zwei Weltkriege Platz fanden, und an den Großvater stößt immer wieder auf Ungesagtes, womöglich Unsagbares. Es ist dieses Schweigen, das als Unvermögen, Generationen überspringend, sich fortpflanzt. Es sind die Memoiren des Urgroßvaters, aus deren Lektüre sie Aufklärung erhofft: „Nimmst sie mit nach Hause, verfasst im Winter 1946 bis 1947. Verfasst als er inhaftiert im grauen Haus.“ Sie befragt beide Vorfahren, indem sie sich selbst fragt: Was haben sie erlebt, was haben sie getan? Das wiederholte Fragen nimmt zuweilen auch obsessive Züge an, geführt von der Furcht vor dem Entsetzlichen und dem Tabu, jemanden aus der Familie zu verurteilen. Denn es geht ihr nicht um’s Verurteilen, sondern um’s Verstehen. Doch die Beschäftigung mit den Erinnerungen des Urgroßvaters nehmen nur etwa ein Viertel des Buches ein. Die Natur und die Erinnerungen an die kindlichen Wahrnehmungen bilden die Tore, Türen und Fenster zur eigenen Persönlichkeit, durch die hindurch sie erblickt, was in dieser Familie schon angelegt war an wohlig Vertrautem und bis dahin unerklärlichen Defiziten:
hörst jetzt die helle stimme
hinter goldenen lettern der
urgroßmutter
wie sie noch leuchten die
konturen ihres lachens
ihrer lockigen haare
hörst jetzt ihre helle stimme
hinter den goldenen lettern der urgroßmutter
von der du nur gewusst dass sie
mit kindern nicht gekonnt
Die Folgen dieser Unfähigkeit versehren die Persönlichkeit der Kinder und Kindeskinder, indem sie sie um die voraussetzungslose menschliche Zuneigung bringen:
ein verdienenmüssen
erwerbenmüssen
von liebe
dass es da seine wurzeln genommen
Das sensuelle Eintauchen ins Kindheitserleben wird von Reflexionen begleitet, die dem Defekt nachgehen.
krämpfe die aus eurer angst
entstanden
euren mechanisierenden gesten
geschnürt
…
durch euren aggressiven frieden
müssen wir jetzt ruhe
von wurzeln an
neu erfinden
Es ist also keine Abrechnung mit den Vorfahren, die Soll und Haben gegenrechnet. Das Soll liegt in der eigenen Verantwortung. Es liegt in der Bewußtwerdung dessen, was das Unglück hervorbringt.
Doch was das Buch aus der Fülle familialer Erzählungen heraushebt, ist die unprätentiöse, an ungewöhnlichen Bildern reiche Sprache, mit der eindrückliche Naturbeschreibung das Nachdenken und Nachfragen an sich bindet. Sprachliche Eigenarten erweisen sich als integraler Teil des poetologischen Zugriffs. Hilfsverben oder manchmal auch Vollverben, die wir ohnehin spontan ergänzen, läßt Schnack gerne weg. Es kommt aber auch vor, daß Nomina fehlen, bedachte Fehlstellen entstehen, wie etwa in: „bald achtzig jahre nach seinem“. – Der Tod muß nicht erwähnt werden. Er sitzt in der Lücke.
Der ganze Text ist durchgehend von einer Musikalität getragen, von einem souveränen Formbewußtsein, einer sprachlichen Sorgfalt, die reine Lesefreude erzeugt:
gehst das wasser entlang um
deine gedanken zu
verrauschen
um die geschwindigkeit zu
brechen
in der denkende kreise deinen
körper gefangen
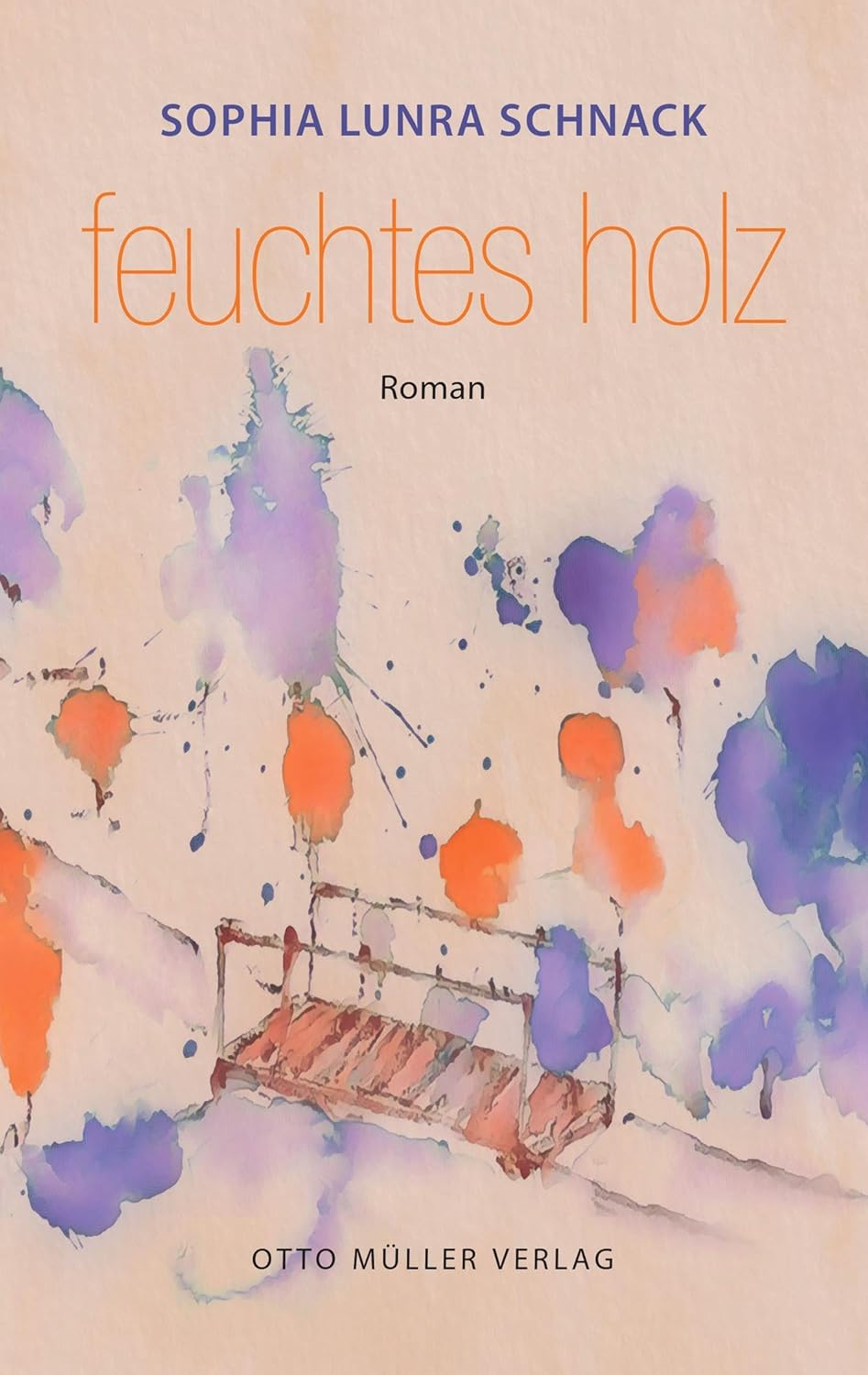
Sophia Lunra Schnack
feuchtes holz
Roman
320 S., geb.
ISBN: 978-3-7013-1308-2
Otto Müller Verlag, Salzburg 2023
Bestellen
Erstellungsdatum: 14.12.2024