


 MENU
MENU
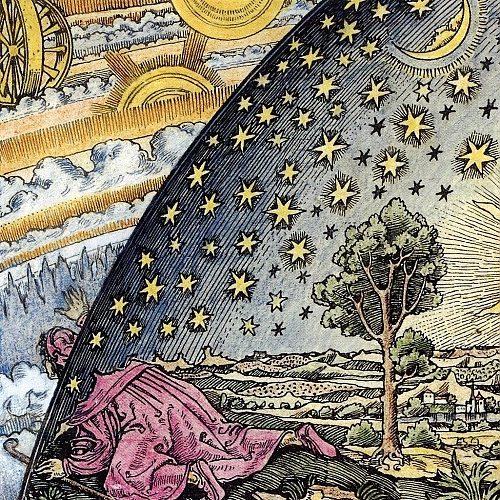
Wer davon ausgeht, dass die Welt in ihrer Totalität ein sinnvolles Ganzes ist, ist ein gläubiger Mensch. Wer, wie Michel Butor, in ihr nur einen zufälligen Haufen Material sieht, fügt sich dennoch dieses Material, um sich zurechtzufinden, zu Sinneinheiten zusammen, lebt also mit Zufall und Notwendigkeit. Thomas Rothschild skizziert, wie sich dieser Befund auf die Künste auswirkt und wie Texte auf ganzheitliche Erwartungen reagieren.
Einer apodiktischen Behauptung steht eine entgegengesetzte gegenüber, die auch als Postulat verstanden werden kann. Die apodiktische Behauptung lautet, dass Totalität unmöglich sei. Die zweite Behauptung besagt, dass nach dieser unmöglichen Totalität gesucht wird oder, versteht man sie als Forderung, dass nach ihr gesucht werden soll. Wie auch immer: Die beiden Behauptungen zusammengenommen ergeben ein Paradox, zumindest aber die Benennung oder die Forderung einer unsinnigen Tätigkeit. Denn wie anders als unsinnig ließe sich die Suche nach etwas, das als unmöglich erkannt wurde, bezeichnen? Es ist also erforderlich und gibt verschiedene Möglichkeiten, den Widerspruch aufzulösen. Ich gehe von der Erfahrung aus, dass Menschen immer wieder nach der Totalität in vielerlei Verständnis gesucht haben und suchen. Wenn also die Menschen nicht mit dumpfer Halsstarrigkeit betreiben, was von vornherein als aussichtslos erkannt wäre, gibt es zwei Modifikationen, die die Suche nach der unmöglichen Totalität von ihrem Defätismus befreien: Entweder die Attribuierung der Totalität als „unmöglich“ ist doch nicht so ernst, doch nicht so endgültig gemeint und eher als Frage zu verstehen; oder die Suche zielt nicht auf ein Finden, sondern auf eine Approximation, auf eine Annäherung an das Unmögliche.
Das eine wie das andere bestimmt de facto die wissenschaftliche, die künstlerische, die politische, die alltägliche Handlungsweise zahlreicher Individuen. Die einen halten die Totalität nicht für grundsätzlich, sondern allenfalls in einer konkreten Gesellschaft für unmöglich und sind auf der Suche nach ihr, sei es auch durch Vorschläge, die gesellschaftlichen Bedingungen zu verändern, die Voraussetzungen für Totalität zu schaffen. Die anderen glauben zwar nicht an die Möglichkeit der Totalität, wohl aber an einen Zustand, der ihr um vieles näher ist als unser gegenwärtiger in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft.
In Bezug auf die Literaturproduktion wird die Frage noch komplizierter. Man kann der Ansicht sein, dass es Totalität gibt, oder dass es sie nicht gibt. Ist man der Ansicht, dass es sie gibt, kann man der Meinung sein, sie sei auch erkennbar, oder aber, dass sie nicht erkennbar sei. Ist man schließlich der Meinung, die Totalität sei nicht nur vorhanden, sondern auch erkennbar, kann man fordern, der Künstler, der Schriftsteller habe diese Totalität in seinem Werk zu erfassen, darzustellen, wiederzugeben. Genau dies sind die Standpunkte, die in der Literaturtheorie und auch in der Praxis konkurrieren: 1. Es gebe keine Totalität, und daher könne auch eine wahrhaftige Literatur sie nicht vortäuschen; 2. es gebe zwar keine Totalität, aber die Kunst dürfe, könne, solle Entwürfe, Utopien einer Totalität schaffen; 3. es gebe zwar eine Totalität, sie sei aber nicht oder nicht mehr erkennbar und daher für die Literatur, jedenfalls für eine realistische, nicht darstellbar; 4. es gebe eine Totalität, die nicht erkennbar sei, der Künstler habe sie aber in seinem Werk zu erahnen und erahnen zu lassen; 5. es gebe zwar eine Totalität, sie sei auch erkennbar, aber es sei nicht Aufgabe der Kunst, sie widerzuspiegeln, zu verdoppeln; 6. es gebe eine Totalität, sie sei erkennbar und es sei Aufgabe der Literatur, sie abzubilden.
Georg Lukács hat bekanntlich den Totalitätsbegriff ins Zentrum seiner „Theorie des Romans“ gestellt. Er schreibt dort: „Unsere Welt ist unendlich groß geworden und in jedem Winkel reicher an Geschenken und Gefahren als die griechische, aber dieser Reichtum hebt den tragenden und positiven Sinn ihres Lebens auf: die Totalität. Denn Totalität als formendes Prius jeder Einzelerscheinung bedeutet, dass etwas Geschlossenes vollendet sein kann; vollendet, weil alles in ihm vorkommt, nichts ausgeschlossen wird und nichts auf ein höheres Außen hinweist; vollendet, weil alles in ihm zur eigenen Vollkommenheit reift und sich erreichend sich der Bindung fügt. Totalität des Seins ist nur möglich, wo alles schon homogen ist, bevor es von den Formen umfasst wird; wo die Formen kein Zwang sind, sondern nur das Bewusstwerden, nur das Auf-die-Oberfläche-Treten von allem, was im Inneren des zu Formenden als unklare Sehnsucht geschlummert hat; wo das Wissen die Tugend ist und die Tugend das Glück, wo die Schönheit den Weltsinn sichtbar macht.“(1) Gewiß, Lukács spricht vom Roman, in dem er die repräsentative Form des Zeitalters erblickt.(2) Aber es besteht kein Zweifel, dass sich dahinter ein grundsätzliches Bild von der anzustrebenden Aufgabe der Literatur und der Kunst verbirgt, die nach Lukács' Auffassung lediglich vom Roman – und zwar vom Roman nach dem Modell des 19. Jahrhunderts – am besten erfüllt werden kann. In „Beiträge zur Geschichte der Ästhetik“ schreibt Lukács pauschal: „Die wirkliche Kunst tendiert daher auf Tiefe und Umfassung. Sie ist bestrebt, das Leben in seiner allseitigen Totalität zu ergreifen. Das heißt, sie erforscht, so weit wie möglich in die Tiefe dringend, jene wesentlichen Momente, die hinter den Erscheinungen verborgen sind, aber sie stellt sie nicht abstrakt, von den Erscheinungen abstrahierend, sie ihnen gegenüberstellend dar, sondern gestaltet gerade jenen lebendigen dialektischen Prozess, in dem das Wesen in Erscheinung umschlägt, sich in der Erscheinung offenbart, sowie jene Seite desselben Prozesses, in welchem die Erscheinung in ihrer Bewegtheit ihr eigenes Wesen aufdeckt. [...] Die echte Kunst stellt also immer ein Ganzes des menschlichen Lebens dar, es in seiner Bewegung, Entwicklung, Entfaltung gestaltend.“(3)
Ich glaube nicht an eine lineare, teleologische Entwicklung der Künste. Wohl aber gibt es Tendenzen, die zu bestimmten Zeiten, bedingt durch Gesetzmäßigkeiten in der Evolution des künstlerischen Materials, durch gesellschaftliche Veränderungen und durch das Wechselspiel zwischen diesen und jenen, verstärkt, deutlicher, wirksamer zur Geltung kommen als andere und als sie selbst zu anderen Zeiten. Eine solche Tendenz ist in den Künsten des vergangenen Jahrhunderts jene zur Skepsis gegenüber dem Vorhandensein oder, eher noch, der Erkennbarkeit der Totalität. Die zunehmende Entfremdung in der industriellen Gesellschaft, die wachsende Menge an Informationen, die dem einzelnen zugänglich werden, die zunehmende Beschleunigung bei der Aufnahme und Verarbeitung dieser Informationen, die im menschlichen Bewusstsein einhergeht mit Flüchtigkeit, und andere Ursachen haben in größerem Ausmaß als zu anderen Zeiten, etwa in der Romantik, dazu geführt, dass der Mensch im Allgemeinen und der Künstler im Besonderen den Eindruck gewinnt und wiederum vermittelt, die Welt ließe sich nur noch in Ausschnitten, in diskontinuierlichen Sequenzen und Räumen, in isolierten Elementen wahrnehmen bzw. darstellen. Diese Tendenz findet ihren Ausdruck in Gattungen, Formen, Techniken und Prinzipien wie denen des Fragments, der Collage und der Montage, der varietéartigen Nummernfolge, des Magazins, der Traumästhetik – etwa im Surrealismus –, des Reduktionismus – etwa bei John Cage oder, ganz anders, in der Minimal Music –, der Ästhetisierung des alltäglichen Details – man denke an Duchamp oder an Warhols berühmte Suppendosen –, der Verlagerung des Interesses auf das Prozessuale anstatt auf das Werk – etwa in der Konzept-Art.
Ernst Bloch hat bereits 1938 in der Exil-Zeitschrift „Das Wort“ gegen Lukács vorgebracht: „Lukács setzt überall eine geschlossen zusammenhängende Wirklichkeit voraus, dazu eine, in der zwar der subjektive Faktor des Idealismus keinen Platz hat, dafür aber die ununterbrochene ‚Totalität‘, die in idealistischen Systemen, und so auch in denen der klassischen deutschen Philosophie, am besten gediehen ist. Ob das die Realität ist, steht zur Frage; wenn sie es ist, dann sind allerdings die expressionistischen Zerbrechungs- und Interpolationsversuche, ebenso die neueren Intermittierungs- und Montageversuche leeres Spiel. Aber vielleicht ist Lukács‘ Realität, die des unendlich vermittelten Totalitätszusammenhangs, gar nicht so – objektiv; vielleicht enthält Lukács‘ Realitätsbegriff selber noch klassisch-systemhafte Züge; vielleicht ist die echte Wirklichkeit auch Unterbrechung.“(4) Ernst Blochs als Möglichkeit formulierte Gewissheit ist so einleuchtend, dass es schwer verständlich scheint, dass sich noch in den frühen siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als der Schwung der Studentenrevolte dogmatisch erstarrte, zahlreiche Studenten fanden, die das Totalitätskonzept von Lukács gläubig nachbeteten.
Jedes Kunstwerk lässt sich einordnen auf einer Skala, deren Enden bezeichnet sind durch das Gegensatzpaar Notwendigkeit und Zufall. Je näher das Werk dem Prinzip der Notwendigkeit rückt, umso mehr ist seine zeitliche oder räumliche Struktur voraussagbar. Folgt es dem Prinzip der Notwendigkeit vollkommen, wird es redundant, uninteressant. Je näher das Werk dem Prinzip des Zufalls rückt, desto weniger prognostizierbar ist seine Struktur. Je geringer die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines bestimmten Elements, desto größer sein Informationswert. Jedes Element des zur Verfügung stehenden Repertoires kann, wo der Zufall ausschließlich herrscht, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftreten. Das Werk wird als beliebig empfunden. In der Praxis wird es sich also im Bereich der Möglichkeit, zwischen Zufall und Notwendigkeit oder, in einer anderen Terminologie, zwischen Chaos und Klischee, bewegen. Der ins Exil gejagte (und wie so viele andere nie zurückgeholte) österreichische Kunstwissenschaftler Gombrich formuliert: „Es ist der Kontrast zwischen Unordnung und Ordnung, was unsere Wahrnehmung alarmiert.“ Und: „Vergnügen liegt irgendwo zwischen Langeweile und Verwirrung.“(5)
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als in der europäischen Kultur normative Poetiken die Literaturproduktion bestimmten, hatte das Prinzip der Notwendigkeit vorrangige Bedeutung. Es waren die minimalen Abweichungen von diesem Prinzip, die verhinderten, dass jedes Werk nur eine genaue Kopie der vorausgegangenen Werke war. Mit dem Geniekult und der Etablierung der Originalität als einer der höchsten Werte in den Künsten verliert das Prinzip der Notwendigkeit an Bedeutung. Im zwanzigsten Jahrhundert schließlich vermehren sich die Tendenzen, die Voraussagbarkeit noch dadurch einzuschränken, dass die Verfahren der Produktion dem ja auch mehrfach determinierten und zumindest idealiter berechenbaren schöpferischen Individuum, dessen Entscheidungen somit prognostizierbar wären, entzogen und einer objektiven Aleatorik überantwortet werden. Da sich die Beliebigkeit von ausschließlich durch den Zufall generierten – sogenannten stochastischen – Texten aus nicht gewichteten Elementen bald als langweilig erweist, hat man es in der Praxis mit gesteuertem Zufall zu tun: etwa beim objet trouvé (die Steuerung besteht darin, dass eben nicht jedes aufgefundene Objekt gleichermaßen als objet trouvé gilt), bei der Montage, bei seriellen Verfahren. Auch das Zufallselement, das durch Delegation an Interpreten stattfindet – etwa in der Musik bei John Cage und anderen –, bedeutet in Wirklichkeit, wie Pierre Boulez(6) überzeugend argumentiert hat, nur die Verlagerung der künstlerischen Verantwortung, nicht eine Dispensation. Das nicht gesteuerte Zufallsprodukt hat seinen Ort in der experimentellen Kunst, kann amüsieren, auch auf Möglichkeiten verweisen, ist aber gerade wegen seiner Beliebigkeit nicht beliebig wiederholbar. Als Beispiel gelte „Laute Prosa“ von Herbert J. Wimmer, die offenbar die auf dem Lift-off-Korrekturband einer elektrischen Schreibmaschine ablesbare Folge von Buchstaben und Satzzeichen – logischerweise ohne Zwischenräume – als Text deklariert. Die eigentliche Pointe liegt in dem einzigen Element, das Wimmer nicht dem Zufall des Vertippens beim Schreibmaschineschreiben überlassen hat, nämlich im Titel. Der Witz, eine semantisch unsinnige Buchstabenfolge als Prosa zu bezeichnen, wird verstärkt durch den Kalauer, den das homonymische „Laute“ hinzufügt.
Der Gestaltpsychologie verdanken wir die Erkenntnis, dass die menschliche Wahrnehmung auch nicht zusammenhängende Elemente zu einem Ganzen, zu einer Gestalt eben – wenn man so will: zu einer Totalität – verbindet. Eine Grafik besteht aus vier doppelten Dreiviertelkreisen, deren offene Viertel jeweils zum Zentrum gerichtet sind. Dennoch sieht der Betrachter deutlich ein weißes Rechteck, das in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Die von den Dreiviertelkreisen markierte Fläche unterscheidet sich farblich nicht von der umgebenden Fläche.
Was bedeutet das für die Wahrnehmung von Kunst? Dass der Rezipient auch dort, wo der Zufall produzierte, unbewusst bemüht sein wird, eine Gestalt, anders ausgedrückt: ein Organisationsprinzip zu entdecken. Will sagen: Wir nehmen auch das zufällig Angehäufte innerhalb gewisser Grenzen als Ordnung wahr, ergänzen es zu einem geschlossenen Ganzen. Der Prager Strukturalist Jan Mukařovský schrieb in seinem Aufsatz „Beabsichtigtes und Unbeabsichtigtes in der Kunst“: „die Absichtlichkeit ist jene Kraft, die die einzelnen Teile und Komponenten des Werkes zu einer Einheit zusammenknüpft, die Sinn in das Werk hineinbringt. Sobald der Aufnehmende zu einem gewissen Gegenstand eine Haltung einnimmt, wie sie beim Aufnehmen des Kunstwerkes üblich ist, entsteht in ihm sofort das Bestreben, in der Beschaffenheit des Werkes Spuren einer Ordnung zu finden, die es gestattet, das Werk als Bedeutungsganzheit zu begreifen."(7) Es versteht sich, dass Mukařovskýs Begriff der Bedeutungsganzheit kein Synonym ist für Lukács' Totalitätsbegriff. Während jener der Spezifik des künstlerischen Werks gerecht wird, ist dieser, aus der marxistisch-leninistischen Gesellschaftstheorie entlehnt, dem Kunstwerk von außen aufgesetzt. Er funktioniert nur als literatursoziologische, nicht als ästhetische Kategorie. Mukařovský hat freilich auch die Rezeption im Auge. Er meint: „Wohlgefallen entspringt dem Eindruck einer allseitigen, wenn möglich ungestörten Einheit des Werkes; das Element des Missfallens bringen in die Struktur des Werkes notwendig schon die in ihr selbst enthaltenen Gegensätze hinein – umso eher allerdings Gegensätze, die die eigentliche grundlegende Einheitlichkeit der Struktur (und des Bedeutungsaufbaus) stören, indem sie eine Komponente gegen alle übrigen stellen."(8)
Bei Zeitkünsten wie der Musik und der Literatur versucht der Rezipient kontinuierlich herauszubekommen, ob dem Werk ein Ordnungsprinzip zugrunde liegt und wenn ja, welches. Nach jeder formalen und semantisch-thematischen Information entwickelt er eine Erwartung, stellt er eine Hypothese über den weiteren Verlauf des Werks auf. Wird die Erwartung erfüllt, die Hypothese bestätigt, so wächst die Einsicht in das Organisationsprinzip und damit die Voraussagbarkeit. Erweist sich die Hypothese als falsch, so muss das Vorausgegangene retrospektiv uminterpretiert und die Hypothese korrigiert werden.
Lassen Sie mich das an zwei Beispielen demonstrieren, einem amerikanischen Wiegenlied, das auch Joan Baez in ihrem Repertoire hatte, und danach an einem amerikanischen Volkslied, das in der Ich-Form von einem verlassenen Mädchen erzählt.
HUSH, LITTLE BABY
Hush, little baby, don’t you cry; Papa’s going to sing you a lullaby.
Hush little baby don’t say a word; Papa’s going to buy you a mockingbird.
If that mockingbird won’t sing, Papa’s going to buy you a golden ring.
If that gold ring turns to brass, Papa’s going to buy you a looking glass.
If that glass begins to crack, Papa’s going to buy you a jumping jack.
If that jumping jack is broke, Papa’s going to buy you a velvet cloak.
If that velvet cloth is coarse, Papa’s going to buy you a rocking horse.
If that rocking horse won’t rock, Papa’s going to buy you a cuckoo clock.
If that cuckoo clock won’t tick, Papa’s going to buy you a walking stick.
If that walking stick falls down, you’ll still be the sweetest little baby in town!
Die Struktur Wiegenliedes „Hush Little Baby“ ist rasch zu erkennen. Spätestens nach dem fünften Vers hat der Zuhörer seine Hypothesen so weit modifiziert, dass er den weiteren Verlauf des Liedes zwar nicht Wort für Wort, aber formal voraussagen kann – bis auf den Schlussvers, der das Schema durchbricht und mit der formalen Überraschung zugleich die schöne Schlusspointe formuliert, die für die liebende Mutter der Textfiktion von Anfang an feststand.
I am sad and I am lonely
One, two, three, four
I am sad and I am lonely
My heart it will break
My sweetheart loves another
Lord I wish I was dead
My cheeks were once red
As the bloom on a rose
But now they're as white
As the lily that grows
Young ladies take a warning
Take a warning from me
Don't waste your affections
On a young man so free
He'll hug you, he'll kiss you
He'll tell you more lies
Than the crossed eyes on the railroad
Or the stars in the sky
I'm troubled, I' m troubled
I'm troubled in mind
If trouble don't kill me
I'll live a long time
Das zweite Lied, „I'm Sad And I'm Lonely“, ist komplexer in seinem Aufbau. Zwischen der zweiten und der dritten Strophe gibt es eine Zäsur, die die in den ersten acht Versen entwickelte Regularität zerstört und die daher nicht prognostizierbar ist. Es wechselt die Perspektive – das Ich des Liedes redet nicht mehr von sich, sondern adressiert die anderen jungen Frauen –, es wechselt der Tonfall – von der Klage zum Zorn. Zwischen der vierten und fünften Strophe, auf die nur noch die Wiederholung der ersten folgt, gibt es erneut eine Zäsur. Die Elegie der ersten zwei Strophen wird hier mit Blick auf die Zukunft auf einer fantastischen Ebene wieder aufgenommen.
Beide Lieder, sowohl das auf die Schlusspointe hin orientierte Wiegenlied wie auch das zyklische Liebeslied, das die Pointe bereits in der ersten Strophe verrät, häufen Bilder aufeinander – das erste formal äußerst regelmäßig, aber inhaltlich nur durch das realistisch betrachtet eher absurde Bedeutungsfeld der Tierwelt zusammengehalten, das zweite formal vielfältiger, aber mit Vergleichen der konventionellen Liebeslyrik und aus dem Erfahrungsfeld des amerikanischen Westens (Rose, Lilie, Eisenbahnschwellen, Sterne, Hütte, Gebirge, Wildvögel) –, beide entwerfen damit die Totalität eines Gefühls: der Liebe zum Kind im ersten Fall, des Liebesschmerzes einer Verlassenen im zweiten.
Im zwanzigsten Jahrhundert nimmt nun die Disparatheit der thematischen Elemente zu. Die relative Geschlossenheit und Homogenität eines überlieferten Bedeutungsfeldes reicht nicht mehr aus, um die verwirrende Komplexität einer nur noch fragmentarisch wahrgenommenen Welt sprachlich zu simulieren oder um eine adäquate Gegenwelt dichterisch aufzubauen. Jacques Prévert nennt eins seiner schönsten Gedichte fast programmatisch „Inventaire“. In diesem Gedicht werden scheinbar zufällig Dinge aneinandergereiht, die nichts miteinander zu tun haben, wie eben beim Ausmisten eines alten Ladens, in den über Jahre hinweg alles Mögliche wahllos hineingestopft wurde.
Dieses Nebeneinander von Verschiedenartigem macht einen großen Teil des poetischen Reizes dieses Gedichts aus. Schaut man freilich genauer hin, so erkennt man, dass Prévert das scheinbare Chaos durch Organisationsprinzipien konterkariert. Am auffallendsten sind die immer wieder auftauchenden, an Zahl zunehmenden Waschbären, skurril schon als Einfall, im Französischen auch phonetisch noch plastischer: raton laveur. Teilstrukturen werden durch Zahlenreihen erzeugt, die freilich immer dann wieder unterbrochen werden, wenn ihre Regelmäßigkeit ermüdet. Aus der konventionalisierten Benennung von Möbelepochen nach durchgezählten Königen macht Prévert ein Fugato der Zahlen. Es wird mit dem Ordnungssystem des semantischen Kontrasts gearbeitet (Priester: Furunkel, Freudenmädchen: Mater dolorosa, Vegetarier: Kannibale, Petit Poucet: grand pardon) und mit dem Bedeutungsfeld der zum Teil metaphorisch gebrauchten Verwandtschaftsbezeichnungen (oncle Cyprien, Mater dolorosa, papas gâteau). Diese Regularitäten werden wiederum unterlaufen durch eine zusammenhanglose Reihung von idiomatisch festgelegten Zahlen am Ende des Gedichts.
Gerade diese zum Teil durchaus wieder geordnete Anhäufung von nicht Zusammengehörigem, dieser gesteuerte (und freilich nur scheinbare) Zufall suggeriert Totalität. Sie suggeriert die Totalität jener bürgerlichen Kultur, die auch, keineswegs weit hergeholt, der Protagonist von Luis Buñuels surrealistischem Film „Der andalusische Hund“ als Ballast hinter sich herschleppt, und auch dort fehlt neben Kadaver und Klavier der Priester nicht. Es handelt sich freilich nicht um eine Totalität im Sinne von Lukács, also nicht um „jene wesentlichen Momente, die hinter den Erscheinungen verborgen sind“, sondern gerade um die Totalität der Erscheinungen an der Oberfläche, von denen der Rezipient allerdings, was Lukács – etwa in seiner Auseinandersetzung mit Ernst Ottwalt – ausdrücklich leugnet, selbständig auf die „wesentlichen Momente, die hinter den Erscheinungen verborgen sind", schließen kann. Indem vielerlei vorgeführt wird, indem nicht voraussagbar ist, was noch hinzukommt, was ausgespart bleibt, ist auch das nicht Genannte mit einbezogen, ist die Gesamtheit der Erscheinungen auf der Welt mitgemeint. Wo nichts zwingend ist, bleibt auch nichts zwingend außen vor. Die Totalität wird nicht mehr, wie im realistischen Roman des neunzehnten Jahrhunderts, in all ihren Details ausführlich ausgemalt, in ihrer Fülle zu erfassen gesucht – was ohnedies ein hoffnungsloses Unterfangen wäre –, sondern durch das Aufrufen heterogener exemplarischer Bestandteile als Ahnung vermittelt. Gilt hier nun, was Lukács mit Blick auf die Fotomontage schrieb: „Die Einzelheiten mögen in den buntesten Farben erglänzen, das Ganze ergibt ein trostloses Grau in Grau"?(9) Oder scheinen dem heutigen Leser im Vergleich mit Préverts zudem fast humoristischem Gedicht nicht eher die Riesenromane Romain Rollands, den Lukács neben Gorki und Thomas Mann zu seinem Kronzeugen macht, grau in grau? Wie es denn heute auch schwer fällt, mit Lukács in der Entwicklung Johannes R. Bechers einen Beleg für die „Reife der revolutionären Massen“ zu sehen.(10)
Im Übrigen gibt es durchaus eine Verbindungslinie von dem Prévert-Gedicht zurück zum realistischen Roman des 19. Jahrhunderts, einen gemeinsamen Nenner, wenn man nicht die Betrachtungsweise von Lukács, sondern die des sowjetischen Strukturalisten Jurij M. Lotman zugrundelegt: „Während das Kunstwerk ein Modell eines unbegrenzten Objektes (der Wirklichkeit) mit Hilfe eines endlichen Textes schafft, ersetzt es durch seinen Raum nicht einen Teil (richtiger: nicht nur einen Teil) sondern das ganze Leben in seiner Gesamtheit. Jeder einzelne Text modelliert gleichzeitig sowohl ein bestimmtes spezielles als auch ein universales Objekt.“(11)
Martin Walser bedient sich in seinem Roman „Das Einhorn“ des bei Prévert gezeigten Effekts der Beschwörung von Totalität durch Reihung von Verschiedenartigem, wenn er in einer sechs Seiten umfassenden Orgie der Sprachteilchen eindrucksvoller als mit jeder Beschreibung die Totalität von Podiumsdiskussionen – ihrer personellen Besetzung, ihrer Rhetorik, ihrer Ideologie – in der Bundesrepublik der Adenauer-Zeit plastisch werden lässt.
Deutlicher noch als in dem Gedicht von Prévert, dem die Nähe zum Surrealismus anzumerken ist, wird die Erfassung der Totalität durch Nennung von Exemplarischem in einem der schönsten Songs von Bob Dylan, in „A Hard Rain's A-Gonna Fall“.
Auch Dylan reiht disparate Bilder aneinander. Formal – man sieht es auf den ersten Blick – bedient er sich freilich eines strengen Ordnungssystems, das gekennzeichnet ist durch das Stilmittel des syntaktischen Parallelismus. Zu Beginn jeder Strophe stellt ein Zweizeiler nach dem Muster der schottischen Ballade eine Frage. Die erste Strophe benennt Orte, die zweite Gesichtseindrücke, die dritte Gehörtes, die vierte Begegnungen und die fünfte die zukünftige Aktivität. Auch hier gibt es kleine semantische Kontraste als Gegengewicht zur Regelmäßigkeit der Parallelismen (young child:dead pony, white man:black dog, wounded in love:wounded with hatred), es gibt Folgen magischer Zahlen (zwölf, sechs, sieben und wieder zwölf gleich in der ersten Strophe), es gibt zahlreiche Alliterationen, die den Körper mit Brennen und den schwarzen Ast mit Blut verknüpfen. Und gerade dieses Lied vermittelt durch die Parallelisierung ganz verschiedenartiger poetischer Bilder den Eindruck von der Totalität einer Welt, die durch den radioaktiven Regen bedroht ist. Der ebenso einfache wie insistierende Refrain verstärkt diesen Eindruck.
Zufall oder Organisation: Durch die Hintertür kommt der Anspruch auf Totalität über beide Prinzipien wieder herein. Die Anhäufung von Zufälligem verlangt nach Ausfüllung der Leerstellen, vermittelt den Eindruck von Proben aus einem in Wahrheit zusammenhängenden Ganzen. Und die Organisation, das Regelsystem bietet sich an als nicht nur ästhetisches Prinzip, sondern zugleich als Modell für übergreifende Strukturen, zuletzt für die Welt in ihrer komplexen Gesamtheit. In der Praxis der Kunst wird sowohl das Prinzip des Zufalls wie das der Organisation kaum je verwirklicht. Totalität sucht und findet die Kunst in der Regel innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Zufall und Organisation, zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Spontaneität und Regelsystem, zwischen Zerfließen und Form, zwischen vitaler Entgrenzung und strukturierender Disziplin, zwischen Trieb und Sublimation, zwischen anything goes und Norm, zwischen Selbstverwirklichung und Sozialisierung. So vermag – den Dialektiker wird es nicht wundern – gerade der Verzicht auf Repräsentation der Totalität deren Möglichkeit, ja deren Existenz zu suggerieren.
Anmerkungen
1 Georg Lukács: Die Theorie des Romans, Darmstadt und Neuwied 1971, S. 26
2 Die Theorie des Romans, a.a.O., S. 82
3 Georg Lukács: Schriften zur Literatursoziologie, Neuwied und Spandau 1961, S. 229
4 Die Expressionismusdebatte. Materialien zu einer marxistischen Realismuskonzeption. Herausgegeben von Hans-Jürgen Schmitt, Frankfurt am Main 1973, S. 186
5 Ernst H. Gombrich: The Sense of Order, Ithaca, New York 1979, S. 6 und 9
6 in seinem Aufsatz „Alea“ von 1957, in: Pierre Boulez: Werkstatt-Texte, Berlin/Frankfurt/M/Wien 1972, S. 100-113
7 Jan Mukařovský: Studien zur strukturalistischen Ästhetik und Poetik, München 1974, S. 36
8 Studien zur strukturalistischen Ästhetik und Poetik, a.a.O., S. 56
9 Die Expressionismusdebatte, a.a.O., S 211
10 Die Expressionismusdebatte, a.a.O., S. 222
11 Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte, München 1972, S. 303
Erstellungsdatum: 11.08.2025